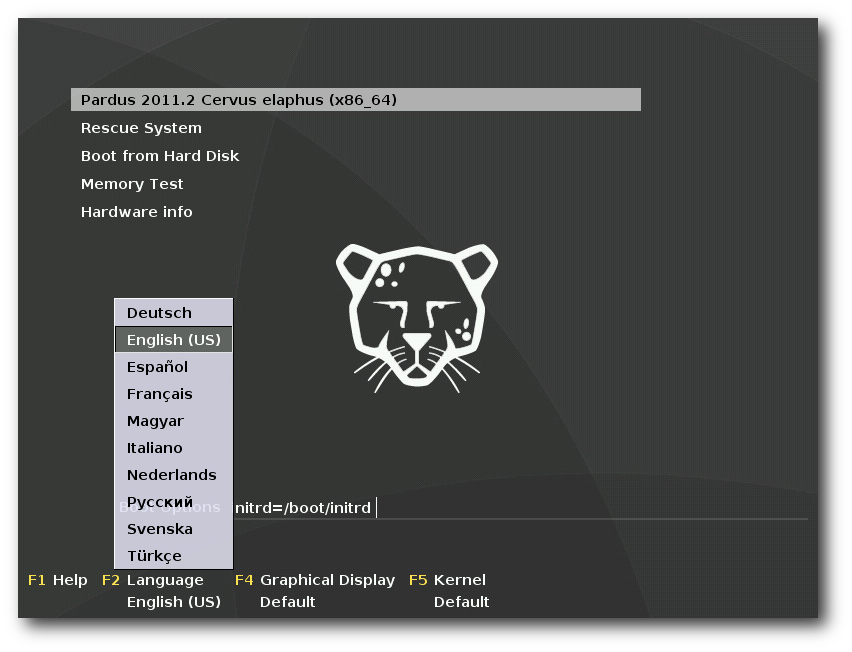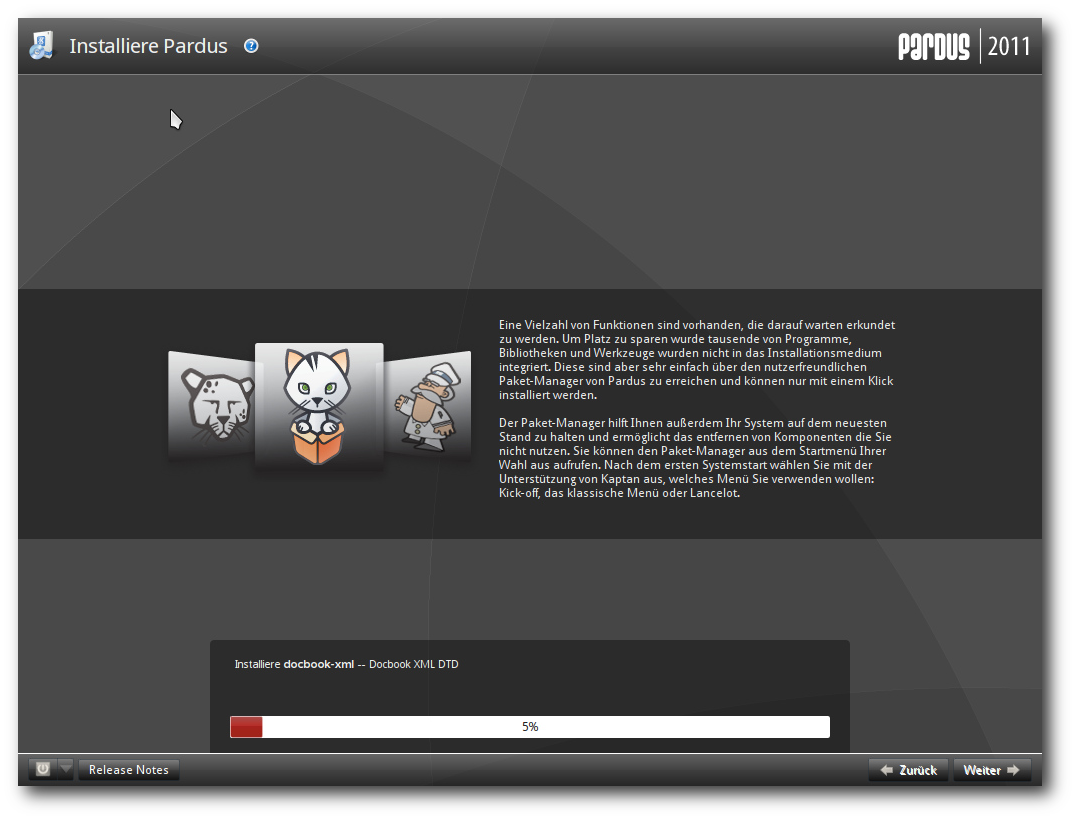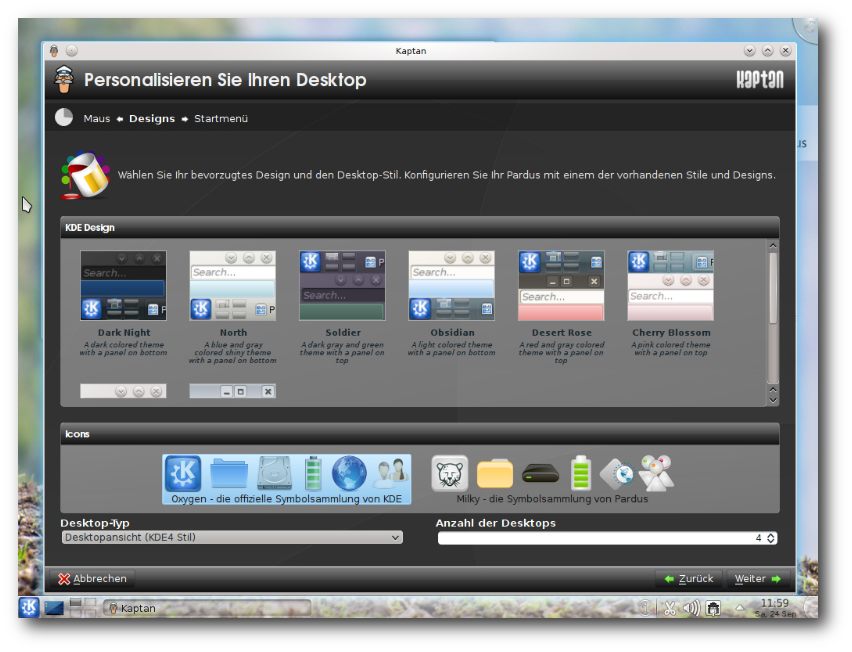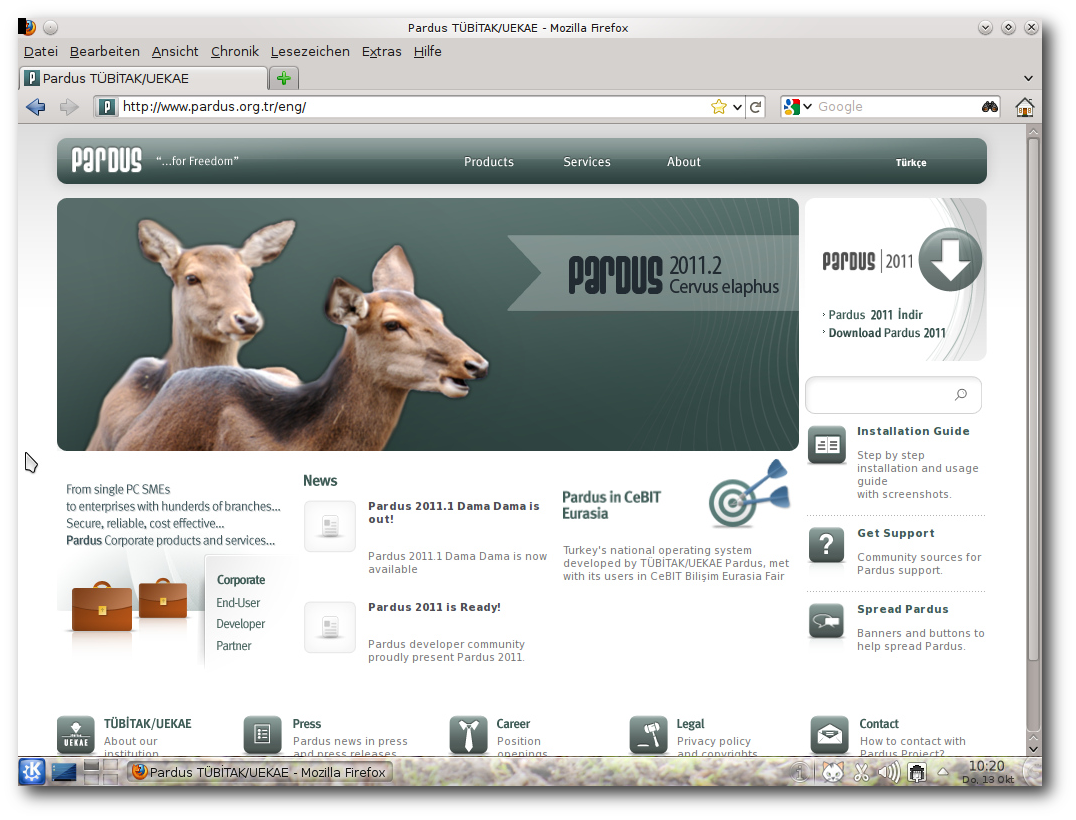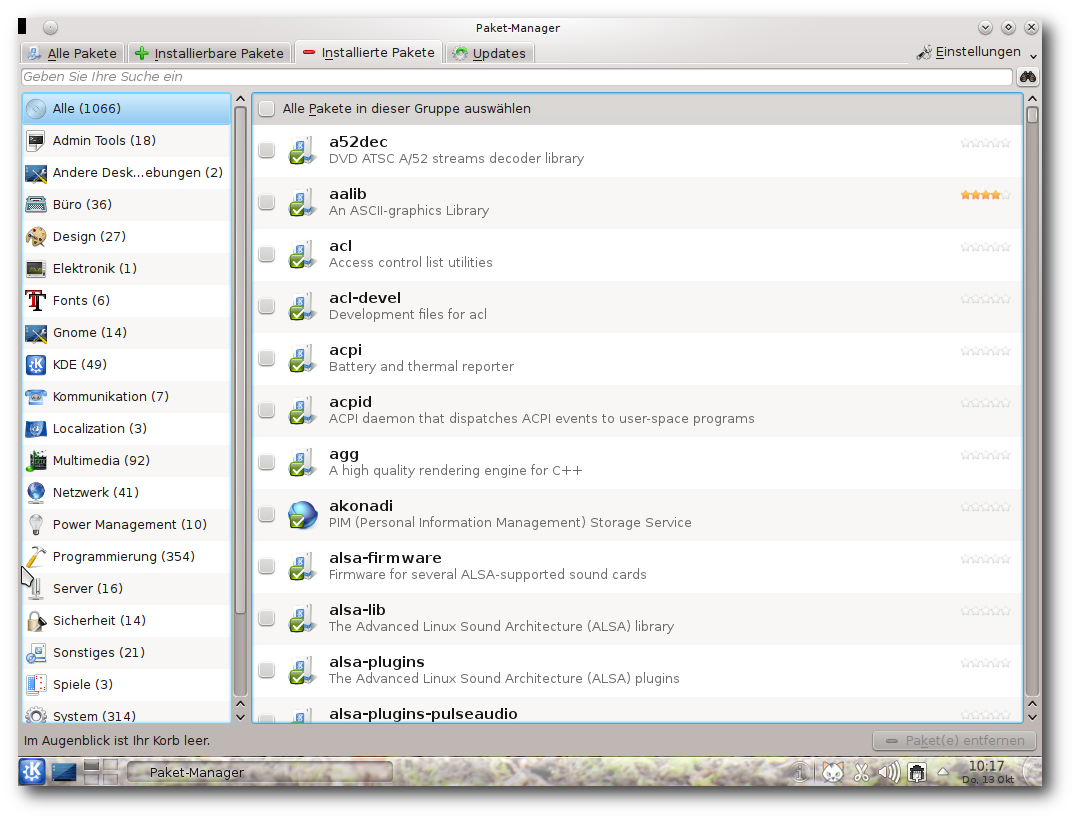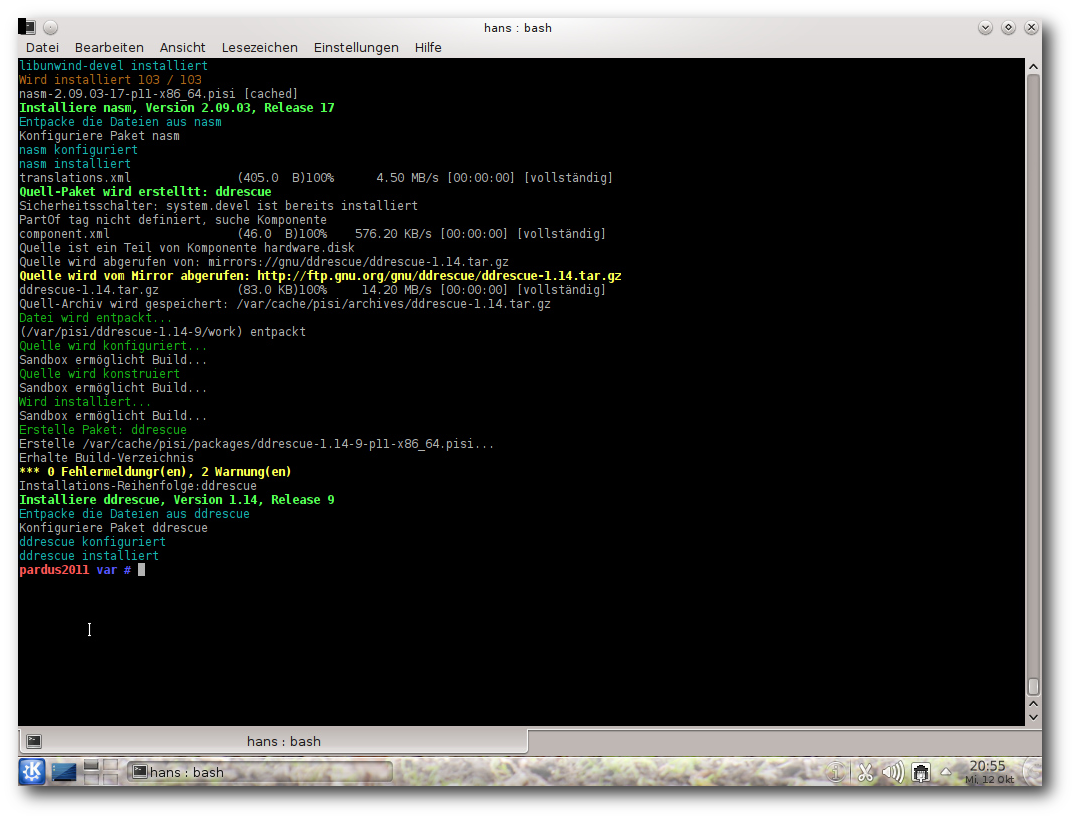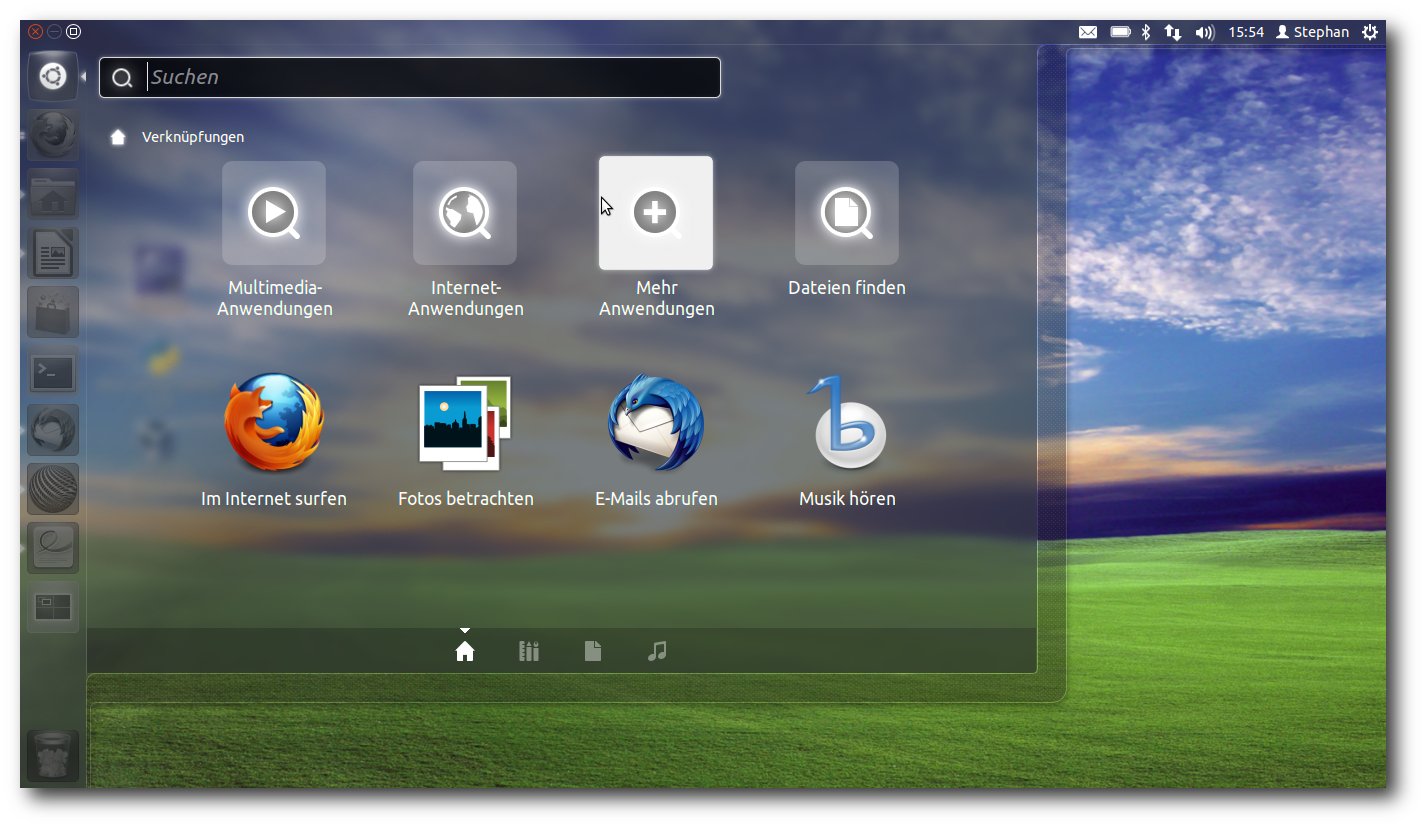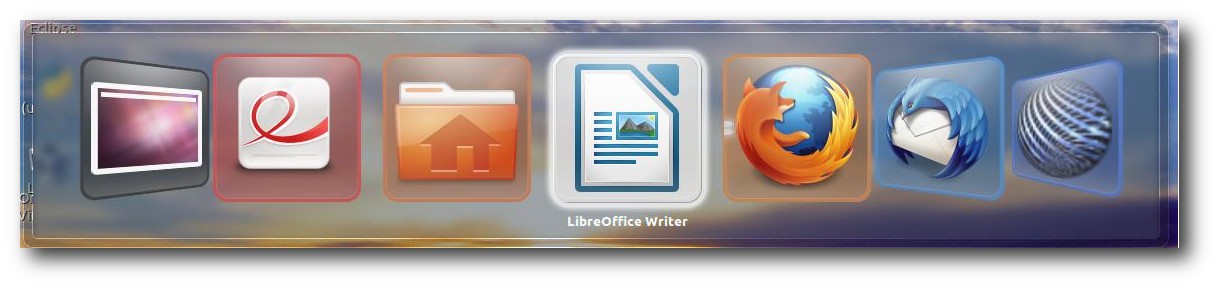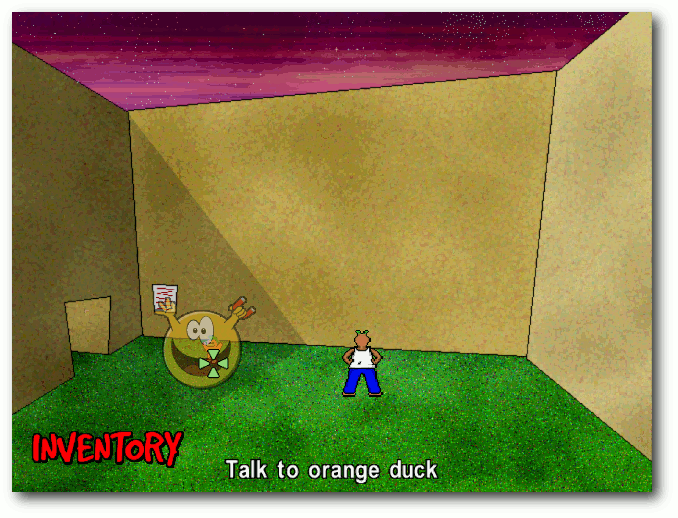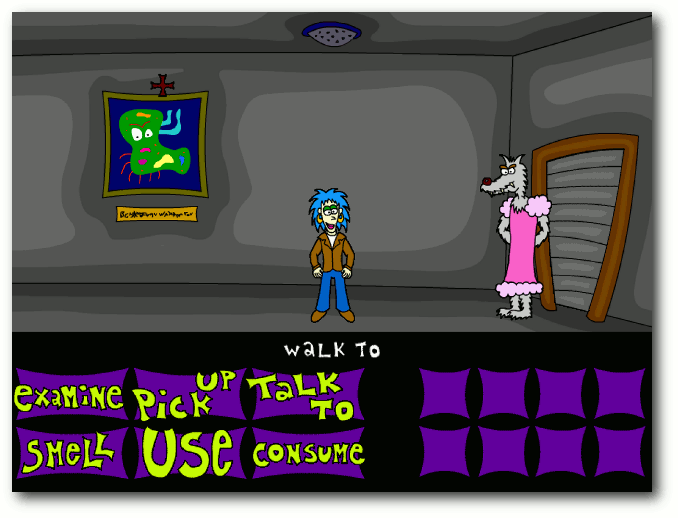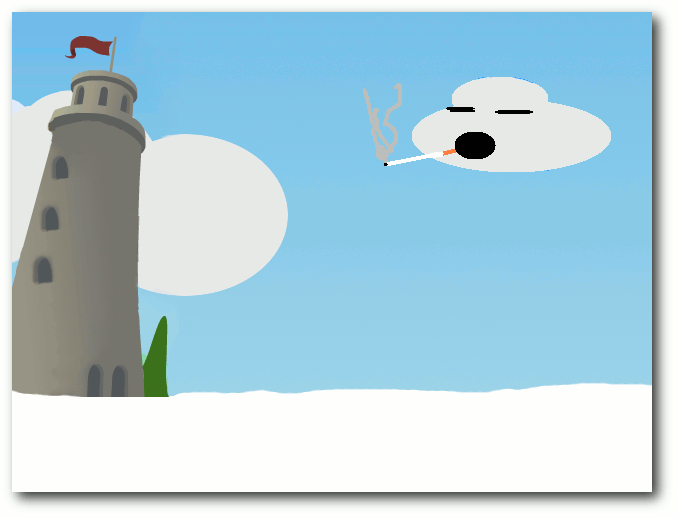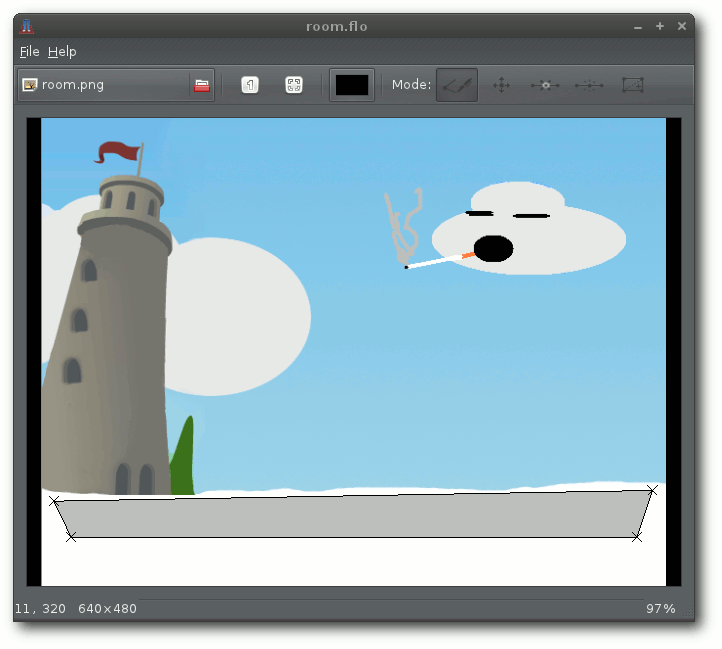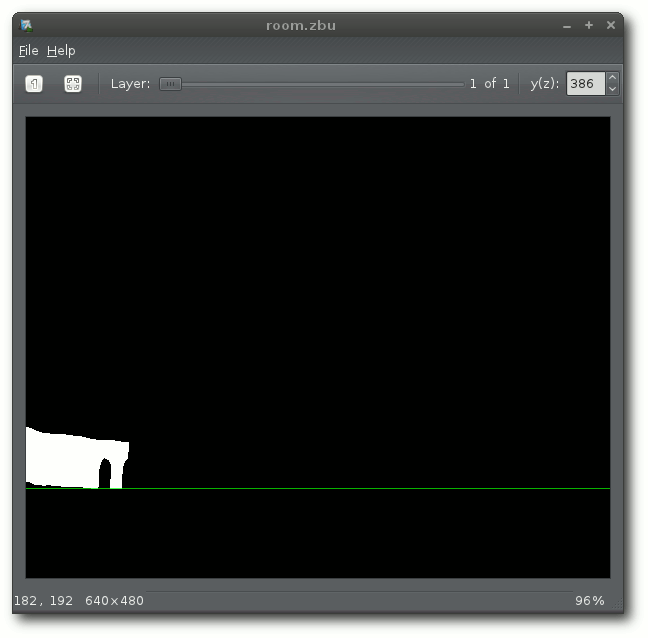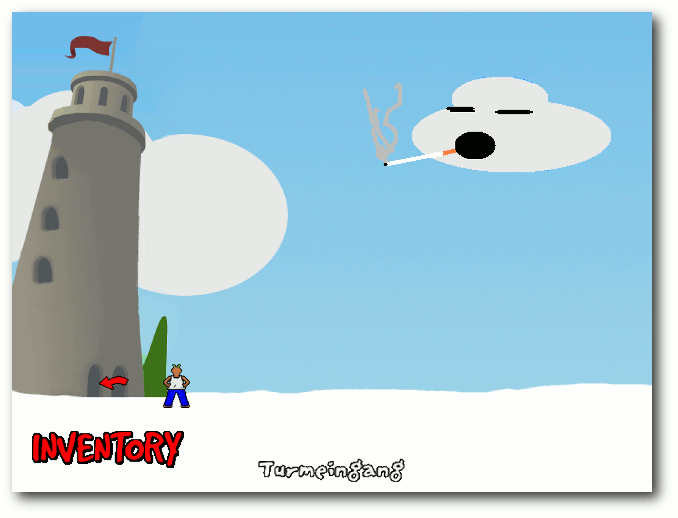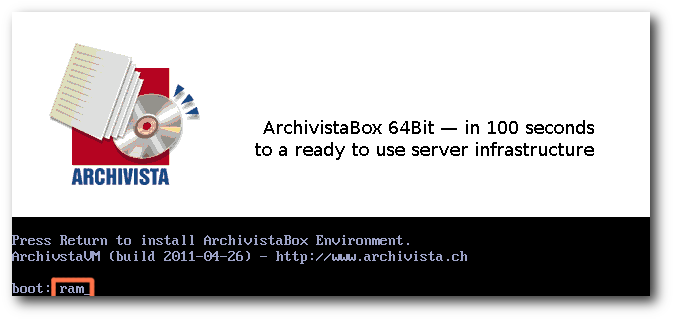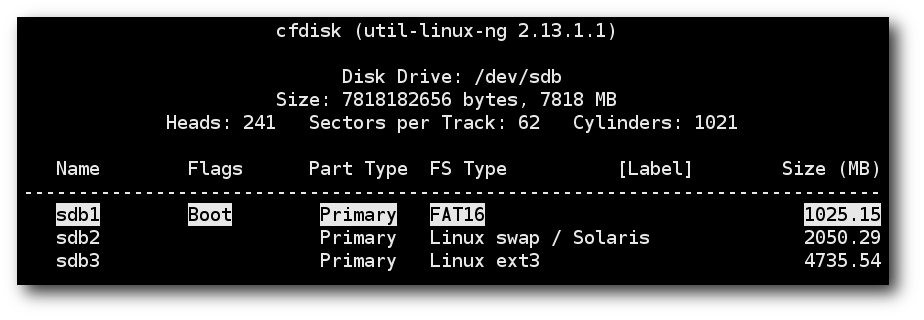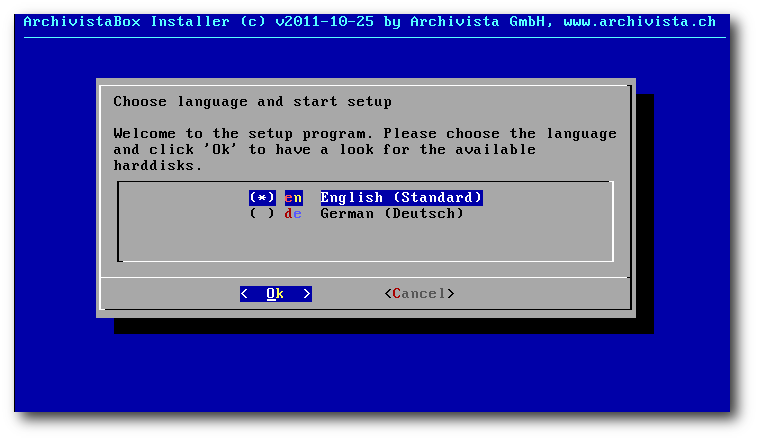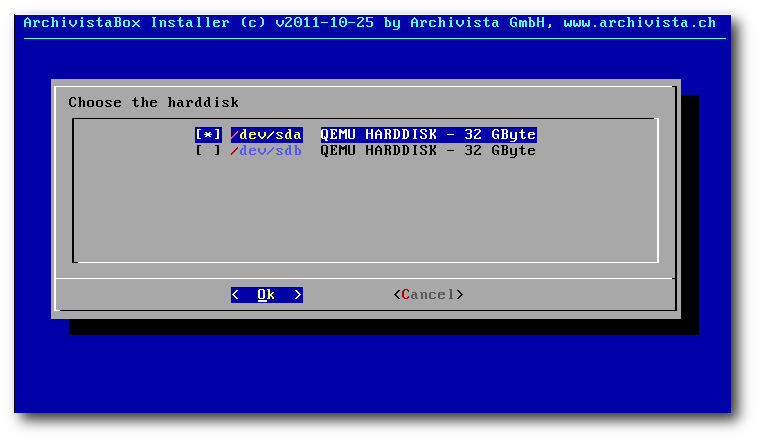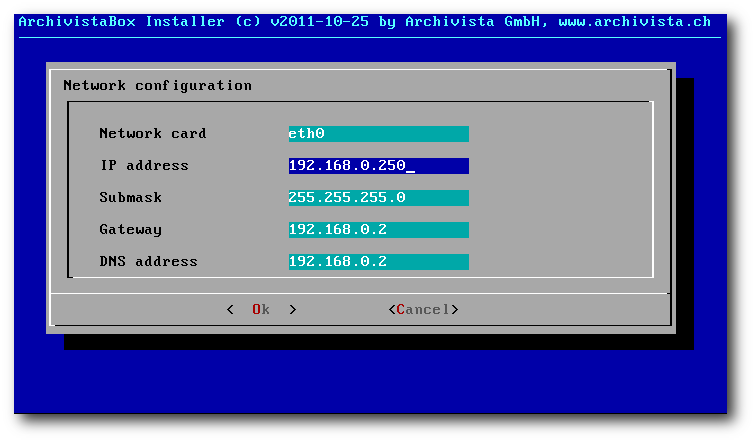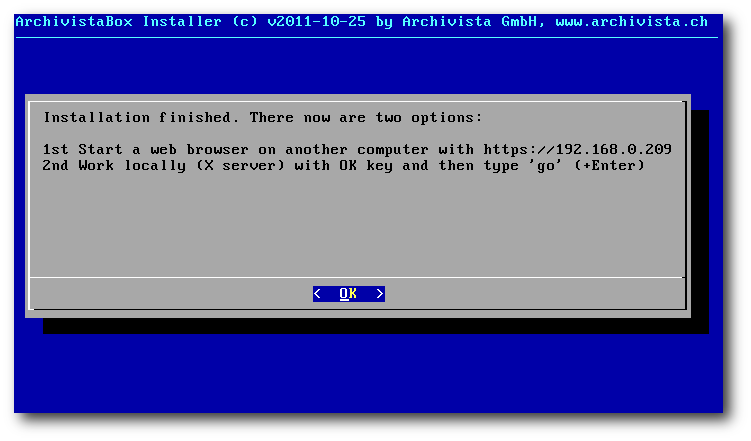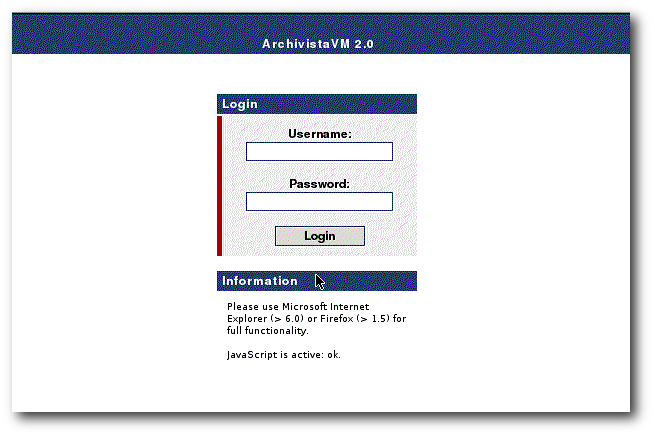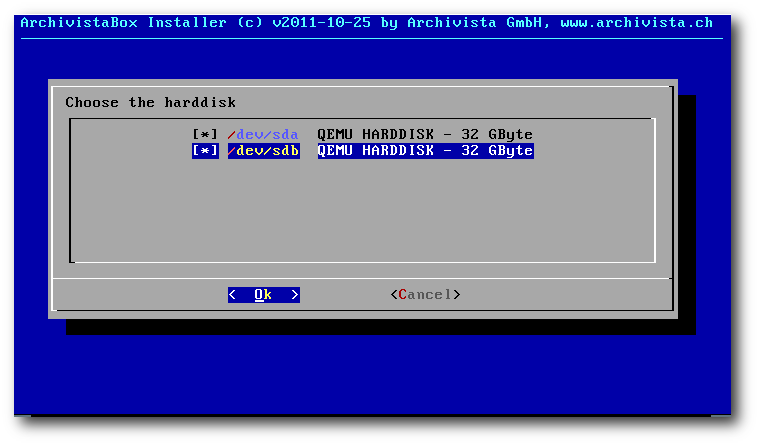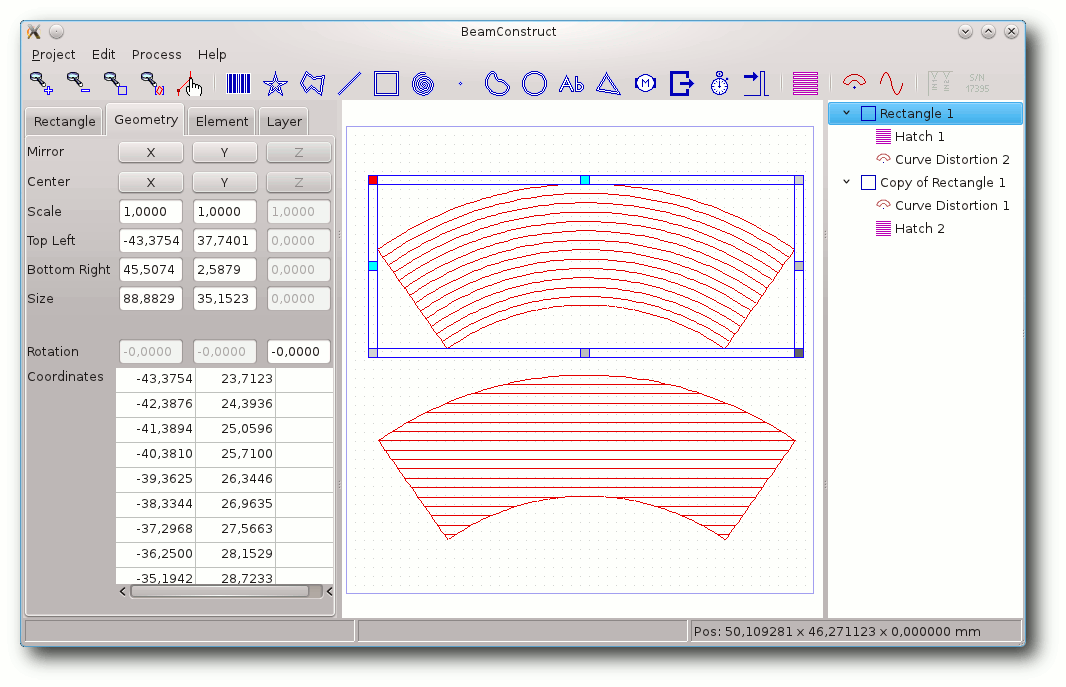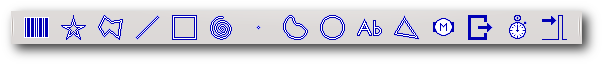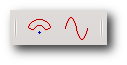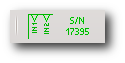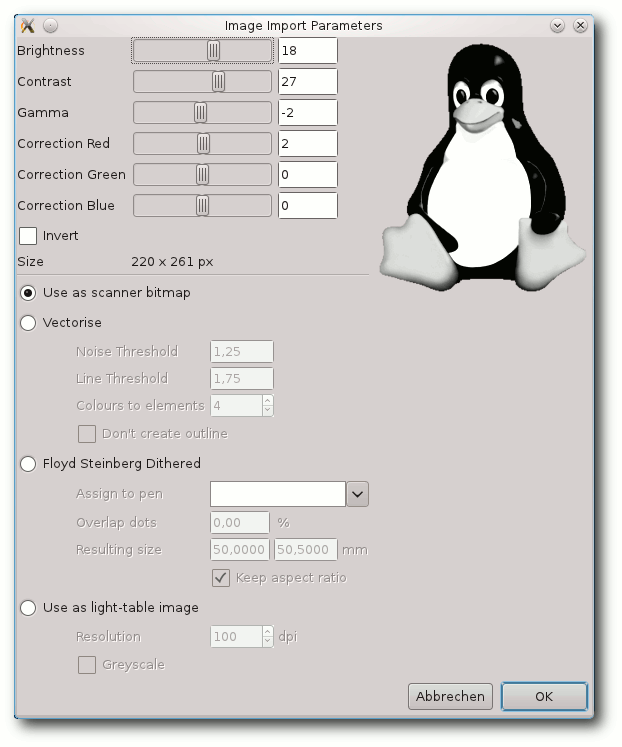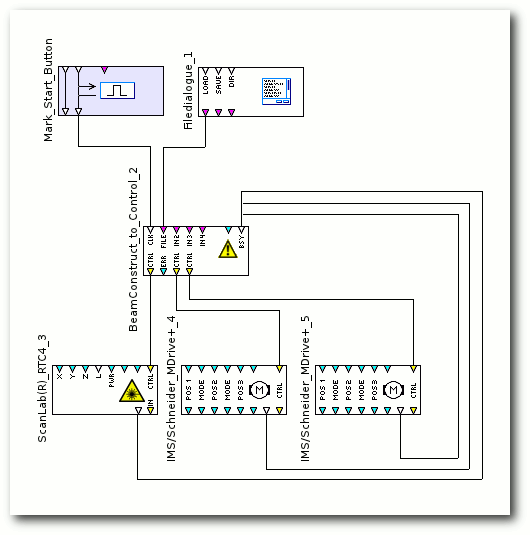Zur Version ohne Bilder
freiesMagazin Dezember 2011 (ISSN 1867-7991)
Topthemen dieser Ausgabe
Python-Frameworks für HTML-Formulare
Python ist heutzutage eine feste Größe unter den Programmiersprachen – auch, wenn es um das Schreiben von Webanwendungen geht. Wer eine solche programmiert, möchte früher oder später auch Daten vom Nutzer eingeben lassen. Hier kommen dann HTML-Formulare ins Spiel. Im Rahmen des Artikels werden fünf verschiedenen Frameworks für Python vorgestellt, welche den Umgang mit diesen Formularen erleichtern sollen. (weiterlesen)
Grafikadventures entwickeln mit SLUDGE
Adventure-Fans wird der Name SCUMM sicherlich etwas sagen. SLUDGE ist eine freie Alternative dazu und bringt selbst noch Entwicklerwerkzeuge mit. Mit diesem System kann man auf jeder Plattform Grafikadventures entwickeln und spielen. Der Artikel soll einen kleinen Einblick in die ersten Schritte der Spielentwicklung mit SLUDGE geben. (weiterlesen)
BeamConstruct – Linux in der Laserindustrie
Das bereits in vorangegangenen Artikeln vorgestellte OpenAPC-Softwarepaket hat mit der vor kurzem neu veröffentlichten Version 2 einige umfassend neue Funktionalitäten erhalten. Neben verschiedenen kleinen Detailverbesserungen, neuen Plug-ins, die zusätzliche Hardware unterstützen und einer kleineren Umorganisation des gesamten Paketes sticht eine Änderung deutlich heraus: Mit der Software BeamConstruct ist jetzt eine Applikation verfügbar, welche auf die Ansteuerung von Laserscannersystemen und generell auf Lasermarkieroperationen hin optimiert ist. (weiterlesen)
Zum Index
Linux allgemein
Pardus 2011.2
Unity
Der November im Kernelrückblick
Anleitungen
Python-Frameworks für HTML-Formulare
Grafikadventures entwickeln mit SLUDGE
PHP-Programmierung – Teil 3
Perl-Tutorium – Teil 4
Python – Teil 10: Kurzer Prozess
Software
ArchivistaVM – Server-Virtualisierung
BeamConstruct
Community
Google Code-In
Rezension: LibreOffice – kurz & gut
Rezension: CouchDB
Magazin
Editorial
Jahresindex 2011
Vorschau
Konventionen
Impressum
Zum Index
Social Networking
Schon seit längerer Zeit ist freiesMagazin in sozialen Netzwerken vertreten, hat dies
aber nie groß bekannt gegeben. Grund dafür ist vor allem, dass die Konten nicht
offiziell von der freiesMagazin-Redaktion eingerichtet wurden, sondern von Fans
des Magazins.
Dennoch haben wir uns entschieden, auf unserer Webseite auf der rechten Seite
diese Konten aufzulisten, sodass man freiesMagazin leichter finden kann.
Neben prominenten Vertretern wie Facebook [1]
und Google+ [2]
ist freiesMagazin auch über Nachrichtendienste wie Twitter [3]
und identi.ca [4] erreichbar.
Auf diesen Seiten kann man, wie auch schon von der freiesMagazin-Webseite gewohnt,
Nachrichten und Updates zu verschiedenen Themen verfolgen.
Allerdings verwenden wir keine „Gefällt mir“-Buttons, da wir nicht mit den
Datenschutzbestimmungen der jeweiligen Dienste einverstanden sind.
Es ist uns bekannt, dass es von Heise eine Zwei-Klick-Lösung
gibt [5], die wir dennoch
nicht einsetzen werden, weil sich am eigentlichen Datenschutz der
Unternehmen nichts ändert.
Ende vierter Programmierwettbewerb
Am 30. November 2011 endete die Einsendefrist für die Teilnahme am
vierten freiesMagazin-Programmierwettbewerb, wie man bereits auf der
freiesMagazin-Webseite lesen konnte [6].
Die Kritik vom vorigen Wettbewerb hatten wir uns zu Herzen genommen und die
Aufgabe einfacher gestaltet, was bei Ihnen wohl sehr gut ankam. Es haben
erfreulicherweise mehr Teilnehmer ihre Bots eingeschickt als das bei irgendeinem
Programmierwettbewerb vorher der Fall war.
Insgesamt traten so 20 Bots gegeneinander an.
In den nächsten Tagen findet dann die Ausführung des Wettbewerbs
statt, so dass wir die Gewinner noch in der Vorweihnachtszeit auf der
freiesMagazin-Webseite und dann in der Januar-Ausgabe im Magazin bekannt geben können.
Index 2011
Wie jedes Jahr gibt es in der letzten Ausgabe des Jahres einen
Jahresindex.
Der freiesMagazin-Jahresindex 2011 steht auch auf der Webseite im Archiv [7]
zum
Download bereit.
Und nun wünschen wir Ihnen viel Spaß mit der neuen Ausgabe.
Ihre freiesMagazin-Redaktion
Links
[1] https://www.facebook.com/freiesMagazin
[2] https://plus.google.com/u/0/113071049781738007718
[3] https://twitter.com/#!/freiesmaga_open
[4] https://identi.ca/group/freiesmagazin
[5] http://www.heise.de/extras/socialshareprivacy/
[6] http://www.freiesmagazin.de/20111201-vierter-programmierwettbewerb-beendet
[7] http://www.freiesmagazin.de/archiv
Das Editorial kommentieren
Zum Index
von Hans-Joachim Baader
Obwohl die Linux-Distribution Pardus vom türkischen Staat gefördert
wurde, richtet sie sich an ein internationales Publikum. Sie nutzt
diverse Eigenentwicklungen, die sie deutlich von anderen abheben.
Grund genug, einmal einen näheren Blick zu riskieren.
Redaktioneller Hinweis: Der Artikel „Pardus 2011.2“ erschien erstmals bei
Pro-Linux [1].
Vorwort
Was fällt einem beim Stichwort Pardus ein? Wer sich daran erinnert,
dass in diesem Jahr Pardus 2011 sowie die Updates Pardus 2011.1 und
Pardus 2011.2 veröffentlicht wurden, dem sind vielleicht Begriffe
wie das Installationsprogramm YALI (Yet Another Linux Installer),
die eigenständige Paketverwaltung PISI und das Programm Kaptan zur
individuellen Anpassung des Desktops (Pardus setzt dabei ganz auf
KDE) keine Unbekannten. Durch diese Eigenentwicklungen unterscheidet sich
Pardus deutlich von anderen Distributionen wie z. B. Debian, Fedora,
Kubuntu, Mageia/ Mandriva oder Opensuse, obwohl der größte Teil der
Software doch wieder identisch mit den anderen ist. Doch das ist
noch nicht alles, wie der Artikel zeigen wird.
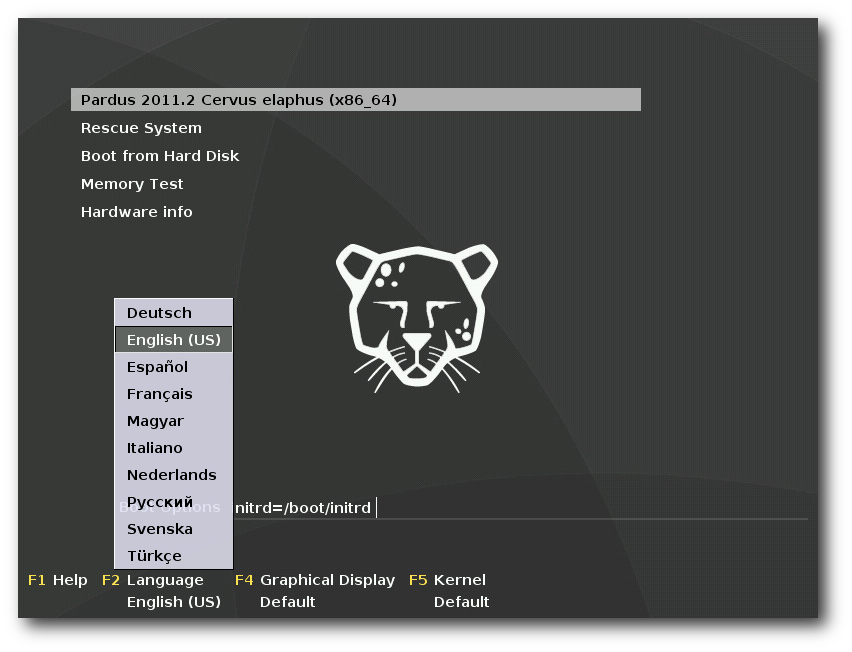
Booten von der DVD.
Installation
Pardus 2011.2 ist auf die x86-Architektur beschränkt. Es steht in 32-
und 64-Bit zur Verfügung und kann frei von der Webseite [2]
heruntergeladen werden. Neben Installations-DVDs stehen zum
Ausprobieren auch Live-DVDs zur Verfügung. Natürlich ist es auch
möglich, mit den DVD-Images einen bootfähigen USB-Stick zu
konstruieren.
Die Installation läuft grafisch ab und erinnert deutlich an Fedora.
Möglicherweise stammt das Installationsprogramm YALI ja von Anaconda
ab, aber über die Hintergründe ist mir nichts bekannt. Schon beim
Bootprompt kann man die Sprache wählen und beispielsweise auf
Deutsch umschalten. Die deutsche Übersetzung war wohl früher ein
Kritikpunkt, ist inzwischen aber bis auf Kleinigkeiten gut.
Die Installation erlaubt zuerst die Auswahl der
Tastatureinstellungen, dann die lokale Zeit und Zeitzone, und kommt
dann zur Partitionierung. Hier lassen sich, wie inzwischen üblich,
die Optionen Gesamten Speicher verwenden, Vorhandenes System
verkleinern, Freien Speicherplatz verwenden und Manuelle
Partitionierung wählen.
Danach kann man den Bootmanager konfigurieren oder einfach bei den
Standardeinstellungen bleiben. Das war es auch schon, da einige
weitere Einstellungen erst nach der jetzt beginnenden Installation
vorgenommen werden.
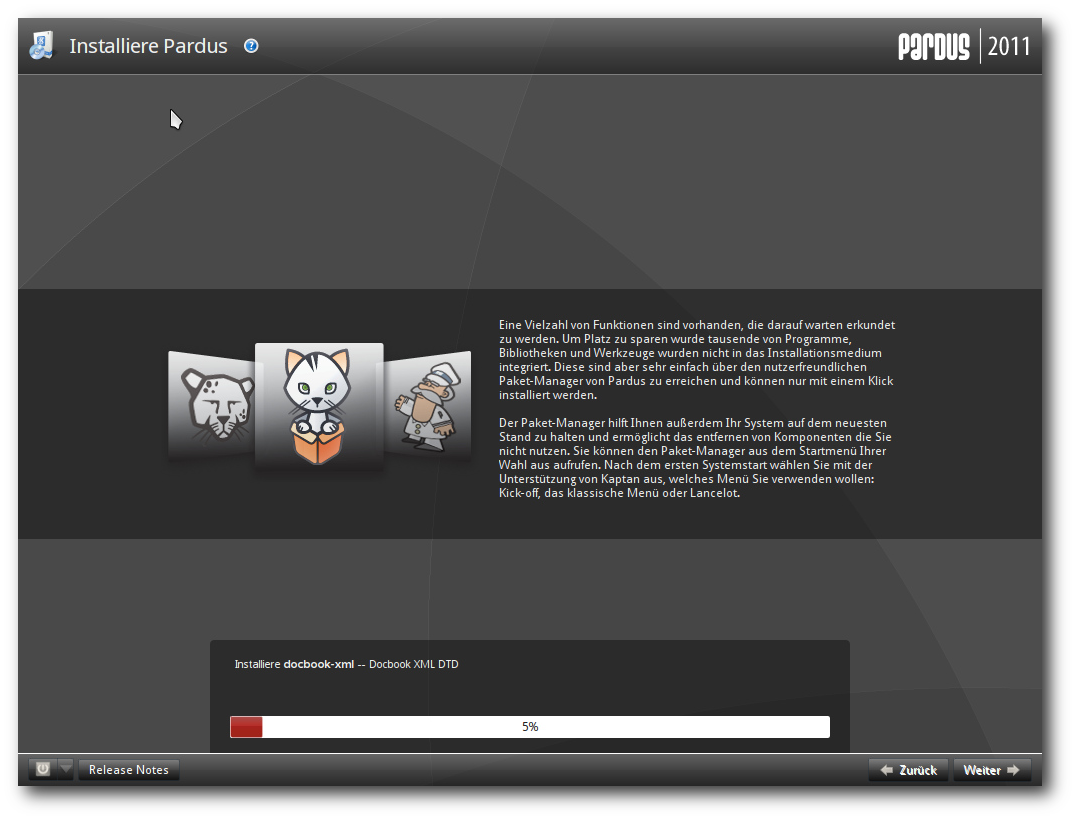
Pardus wird installiert.
Nach der erfolgreichen Installation, die eine Weile dauert, wird das
System hochgefahren und die weitere Konfiguration vorgenommen. Vor
allem erfolgt nun die Festlegung des Root-Passworts und das Anlegen eines
Benutzers für das grafische Log-in. Nun startet KDE zum ersten Mal.
Das ist der Auftritt von Kaptan, einem Wizard, der in wenigen
Schritten die Anpassung des Desktops ermöglicht. Nach der
Einstellung der Maus kann man ein Theme und die Anzahl der
virtuellen Desktops einstellen,
danach einen Menüstil wählen, dann
ein Hintergrundbild und ein Benutzerbild aussuchen, Einstellungen
zum Update vornehmen und schließlich, allerdings optional und
standardmäßig ausgeschaltet, sein Hardwareprofil an den Distributor
senden.
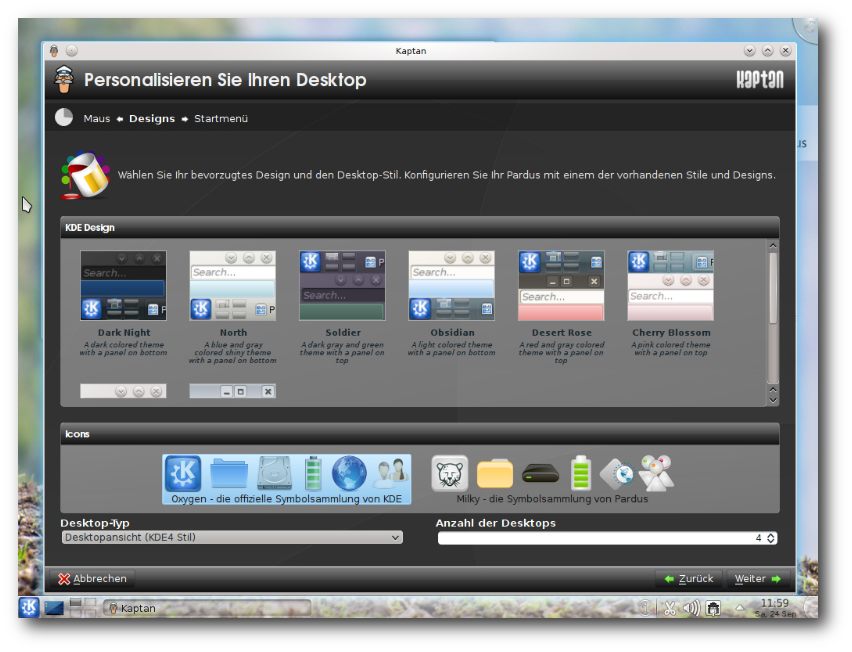
Kaptan hilft beim Einrichten des KDE-Desktops.
Ausstattung
Die Standardinstallation von Pardus 2011.2 bietet etwa 960 Pakete
auf. Enthalten sind unter anderem KDE SC 4.6.5 zusammen mit KDE PIM
4.4.11, LibreOffice 3.4.3, Clementine 0.7.1, Digikam 1.9.0, Firefox
5.0, GIMP 2.6.11, NetworkManager 0.8.5.91, GStreamer 0.10.32.4,
FFmpeg 0.6.1, PulseAudio 0.6.1, Bash 4.1, OpenSSH 5.6, lcms 1.19,
Samba 3.5.10, Python 2.7.1, Perl 5.12.2, Ruby 1.8.7, Lua 5.1.4 Tcl
8.5.10, X-Server 1.9.5 und Kernel 2.6.37.6. Der Standard-Browser ist
Firefox, aber Konqueror steht ebenfalls zur Verfügung.
Mehr als 3700 weitere Pakete sind aus den Online-Archiven
erhältlich, darunter die Desktopumgebungen Enlightenment, LXDE, Xfce
und GNOME 2.32, Entwicklungs- und Server-Werkzeuge sowie Spiele.
Darüber hinaus gibt es hunderte von Paketen, die von der
Gemeinschaft erstellt wurden und in zusätzlichen Repositorien
verfügbar sind. Die Distribution hat damit einen ähnlichen Umfang
wie andere, ist in der Standardinstallation recht aktuell und bringt
alles mit, um ein weitgehend kompatibles Linux darzustellen.
Betrieb
Pardus 2011.2 startet recht flott – 25 Sekunden waren es bis zum
Log-in-Fenster. Für eine durchgehende grafische Darstellung wird
Plymouth verwendet. Der Speicherverbrauch ist mit über 450 MB nach
dem Start recht hoch. Ein Grund dafür ist die in Python geschriebene
Paketverwaltung, aber auch Akonadi trägt einiges bei. Bei längerem
Betrieb erhöht sich der Speicherbedarf noch, da sowohl knotify4 als
auch die als Icon laufende Paketverwaltung permanent CPU-Leistung
und Speicher verbrauchen. Im Laufe eines einzelnen Tages ist der
Zuwachs aber noch vernachlässigbar. Die standardmäßig installierte
KDE-Oberfläche sieht im Wesentlichen aus wie bei anderen
Distributionen.
Will man einen Dienst starten, so sucht man aus Gewohnheit im
Verzeichnis /etc/init.d nach einem entsprechenden Skript. Bei
Pardus findet man nur leere Verzeichnisse vor und stellt überrascht
fest: Pardus benutzt ein ganz anderes Init-System. Weder das
traditionelle SysV-Init noch Upstart noch Systemd steuern den
Betrieb bei Pardus. Stattdessen kommt das selbstentwickelte
Init-System Mudur (von türkisch Müdür, Direktor) zum Einsatz. Es ist
in Python geschrieben, wovon man sich unter /sbin/mudur.py selbst
überzeugen kann. Das Programm wird offenbar von /etc/inittab
gesteuert und weitere Steuerdateien liegen unter etc/mudur. Die zu
startenden Dienste werden dabei durch Dateien definiert, deren Name
den Dienst angibt und deren Inhalt keine Rolle zu spielen scheint,
weshalb sie leer sind.
Multimedia im Browser und auf dem Desktop
Die Softwarepatente in den USA berühren Pardus als europäische
Distribution nicht. Daher sind alle wichtigen freien Codecs im
Standardumfang enthalten, gleichgültig ob sie von Patenten belastet
sind oder nicht. Dadurch ergibt sich unter Pardus die ungewohnte
Situation, dass sich alle relevanten Medienformate ohne
Nachinstallation oder Konfiguration abspielen lassen. In der Tat
werden Dateien, die man mit dem Dateimanager Dolphin öffnet, immer
dem korrekten zuständigen Programm übergeben. In dieser Hinsicht ist
Pardus perfekt.
Die Perfektion setzt sich in Firefox fort. Videos von verschiedenen
Webseiten funktionierten in allen getesteten Fällen dank der
vorinstallierten Plugins, zu denen auch Java und Adobe Flashplayer
11 zählen. In Konqueror scheint der Flashplayer aber leider nicht zu
funktionieren, und andere Videos können nur in externen Playern
abgespielt werden, was allerdings auch problemlos funktioniert.
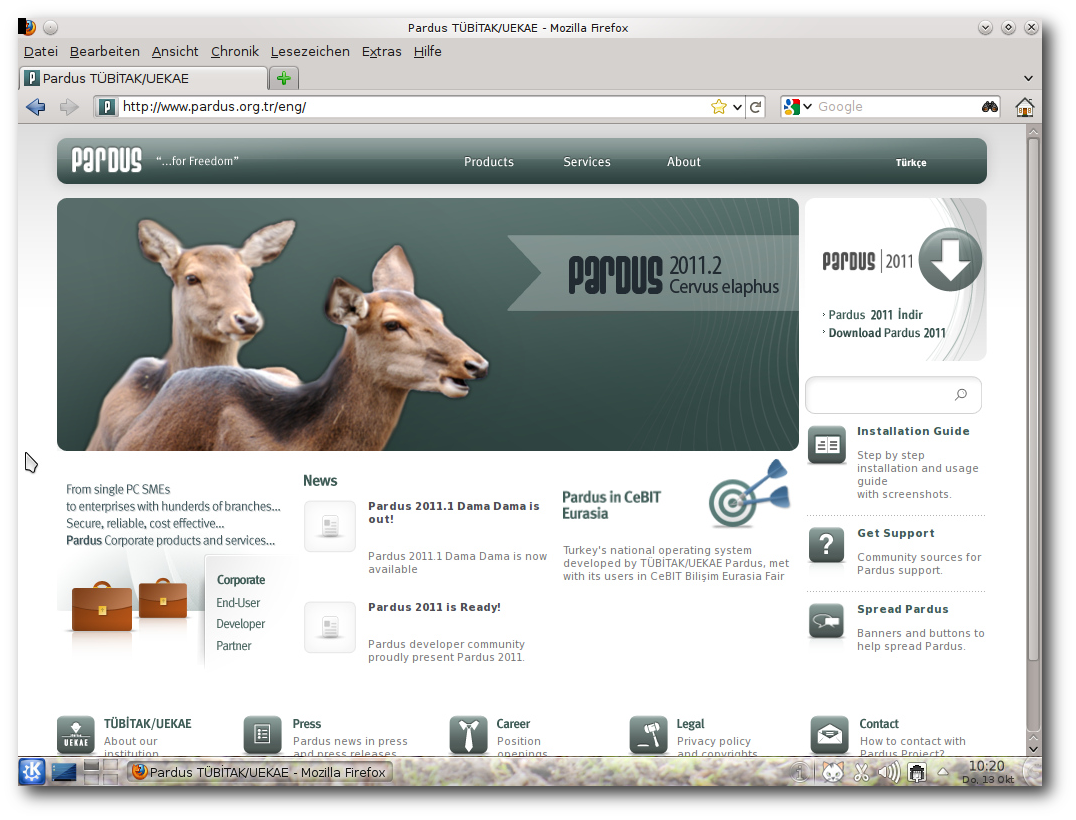
Firefox mit der Pardus-Homepage.
Paketverwaltung und Updates
Die mitgelieferte grafische Paketverwaltung, einfach Paket-Manager
genannt, kommt einem bekannt vor, erinnert sie doch ein Stück
weit
an KPackage, Synaptic oder andere entsprechende Programme. Es ist
ein Programm, das die Aufgaben Konfiguration, Aktualisierung und
Hinzufügen oder Entfernen von Paketen in einem Werkzeug vereinigt.
Es fällt zunächst nicht auf, dass im Hintergrund bei Pardus etwas
ganz anderes arbeitet als bei Fedora oder Ubuntu. Denn auch die
Paketverwaltung ist eine Eigenentwicklung, und auch sie wurde in
Python implementiert. Das Hauptwerkzeug der Paketverwaltung heißt
Pisi [3], was für
„Packages Installed Successfully, as intended“ steht. Es ist weder
zu RPM noch zu Debian-Paketen kompatibel, die Gründe dafür sind auf
der Pisi-Projektseite nachzulesen. Das Kommandozeilenprogramm „pisi“
erinnert in seiner Syntax an Zypper von openSUSE, enthält aber auch
Elemente von Gentoo, denn der Befehl pisi em(erge) lädt
Quellcode-Pakete aus den Repositories herunter, kompiliert und
installiert sie. Damit das funktioniert, muss man lediglich das
passende Quellcode-Depot als Paketquelle hinzufügen. Um alles andere
kümmert sich Pisi.
Besonders interessant dürfte das sein, um Pakete
zu installieren, die für andere Pardus-Versionen konstruiert wurden.
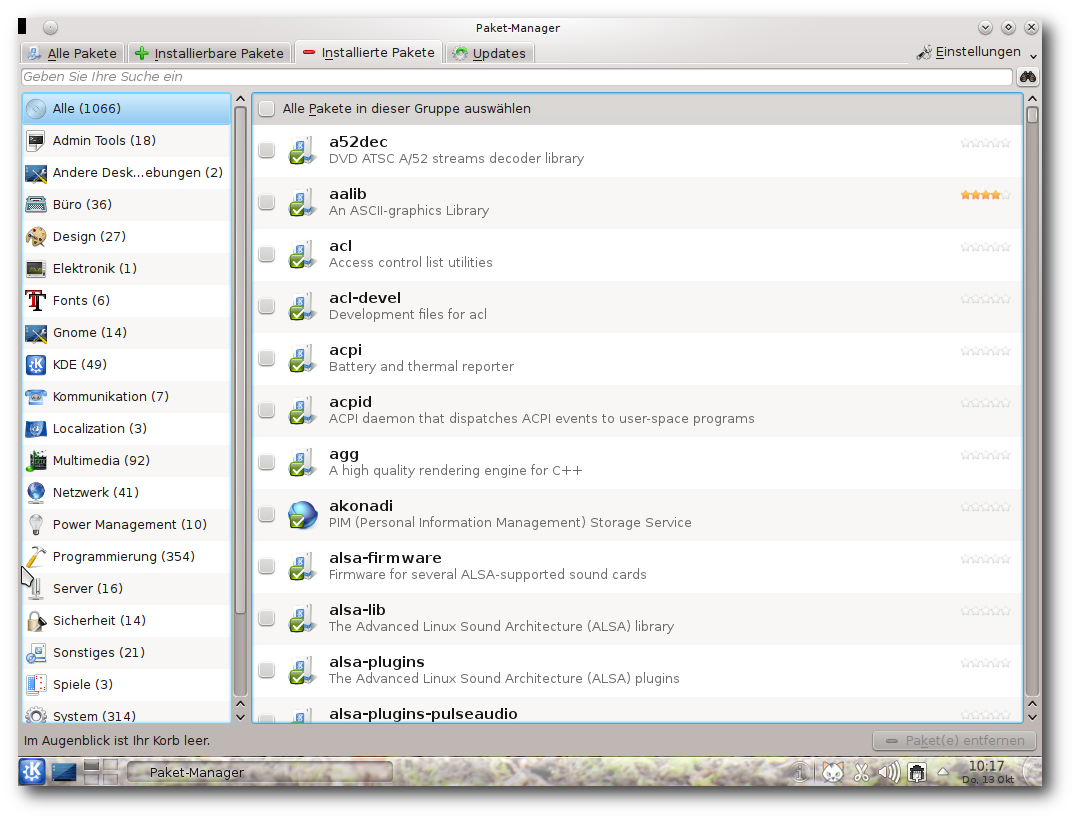
Die Paketverwaltung.
Pisi spielt zusammen mit dem Konfigurationssystem
COMAR [4]
(eigentlich ÇOMAR), dem es die gesamte Konfiguration überlässt.
COMAR, eine weitere Neuentwicklung, steht für Configuration Manager.
COMAR arbeitet auch mit dem Init-System Mudur zusammen.
Eine bemerkenswerte Erweiterung von Pisi ist
Pisibul [5], das Software aus
den Quellen kompiliert und paketiert. Leider ist die letzte Version
0.24 schon vier Jahre alt. Sie lässt sich zwar installieren,
funktioniert aber nicht mehr, da sie wohl nicht an KDE 4 angepasst
wurde.
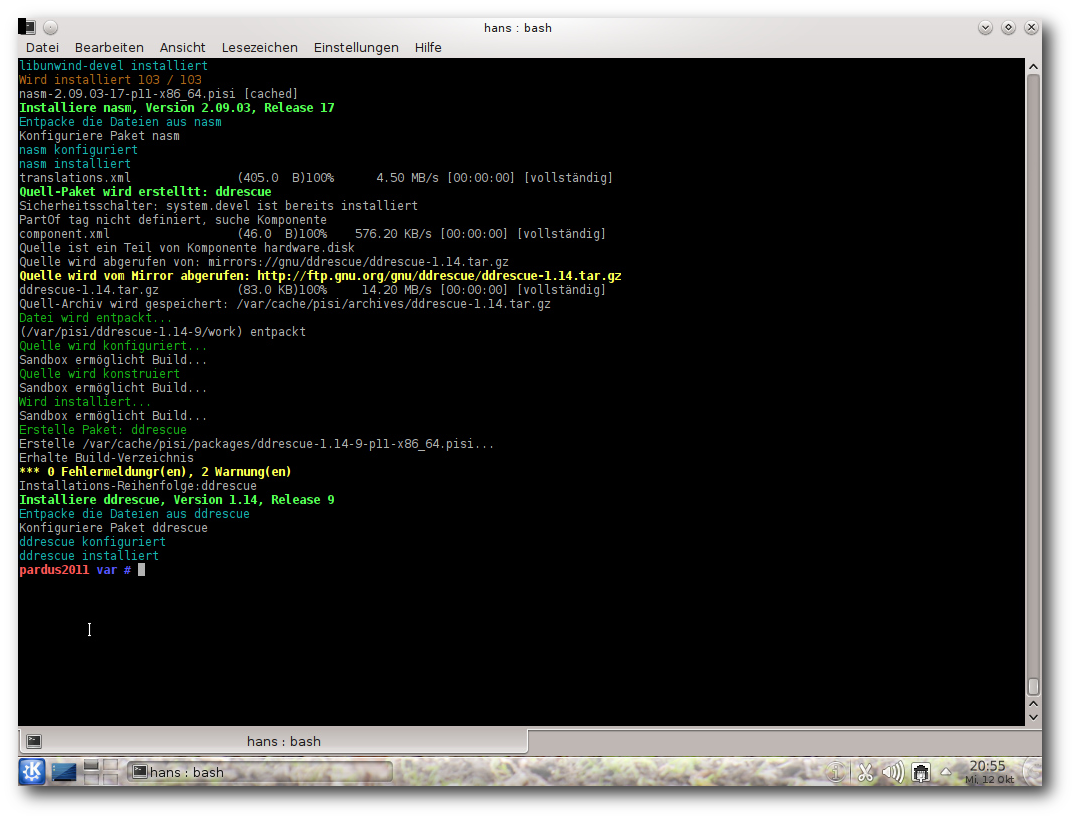
pisi emerge in Aktion.
Fazit
Pardus 2011.2 ist eine bemerkenswert frische Distribution, die einen
Test wert ist. Ihr größter Vorteil ist vielleicht, dass sie erst ab
2003 entstand und nach den ersten Anfängen dazu überging, traditionelle
Paradigmen zu überdenken und durch Neuimplementierungen zu ersetzen.
Alles, was Pardus von anderen Distributionen unterscheidet, wurde in
Python implementiert, was den Entwicklern zufolge zu höherer Geschwindigkeit
und besserer Wartbarkeit führt. Zudem sind bestimmte, in anderen
Programmiersprachen häufige Fehler in Python ziemlich unwahrscheinlich,
und so läuft das System auch sehr stabil und zuverlässig.
Pardus ist nicht die aktuellste Distribution, aber gerade die eher
spärlichen Updates und die lange Lebensdauer der einzelnen Versionen
werden von vielen Benutzern eher als Vorteil denn als Nachteil
gesehen. Nur alle ein bis zwei Jahre erscheint eine ganz neue
Version. Der Umfang der Distribution ist, wenn man die
Online-Repositorien einbezieht, ausreichend, und zusätzliche
Repositorien von Anwendern und Anwendergruppen sowie die
Möglichkeit, Pakete aus dem Quellcode zu erstellen, erweitern das
Angebot erheblich.
Links
[1] http://www.pro-linux.de/artikel/2/1532/pardus-20112.html
[2] http://www.pardus.org.tr/en
[3] http://www.pardus.org.tr/eng/projects/pisi/index.html
[4] http://www.pardus.org.tr/eng/projects/comar/index.html
[5] http://en.pardus-wiki.org/Pisibul
| Autoreninformation |
| Hans-Joachim Baader (Webseite)
befasst sich seit 1993 mit Linux. 1994 schloss er sein
Informatikstudium erfolgreich ab, machte die Softwareentwicklung
zum Beruf und ist einer der Betreiber von Pro-Linux.de.
|
| |
Diesen Artikel kommentieren
Zum Index
von Stephan Scholz
Seit Ubuntu 11.04 (Natty Narwhal) ist die Benutzeroberfläche Unity
fester Bestandteil des Betriebssystems. War ein Wechsel zu
Ubuntu-Classic hier noch möglich, hat sich die Lage nach einer
Standardinstallation von Ubuntu 11.10 geändert: Nun kann man (nur
noch) zwischen der 3D- und der 2D-Variante von Unity auswählen –
es folgt ein Blick auf die Neuerungen.
Der Anmeldebildschirm
Unter dem GNOME Display Manager verhält sich der Anmeldevorgang wie
gewohnt. Ab der Ubuntu-Version 11.10 verwendet Ubuntu den Display
Manager LightDM.
Mit diesem ist es möglich, die Barrierefreiheit zu gewährleisten, z. B. mittels
Bildschirmtastatur oder Bildschirmlupe.
Diese Tools sind für Tablet-PCs besonders wichtig, da diese meist
über keine Tastatur verfügen.
Der Startbildschirm
Nach dem Anmeldevorgang befindet man sich auf der ersten
Arbeitsfläche.
Von dort aus gelangt man über die linke Leiste (Starter) in das
Unity Menü (Dash), in die vorgegebenen Programme und zum Mülleimer.
Am oberen Rand befinden sich Menüs zum schnellen Zugriff auf das
Me-Menü, auf Hardware-Dienste (wie Audio- und
Netzwerk-Einstellungen) und andere Dienste eines modernen
System-Trays. Eine große Neuerung, die mit Unity eingeführt wurde,
ist, dass Programme ihre Menüleiste in diesen oberen Rand legen.
Über diesen Schnellzugriff gelangt man beim Darüberfahren mit der
Maus, wenn kein Programmfenster aktiv ist, zu den aus GNOME 2.3
bekannten Verknüpfungen zu den „Persönlichen Ordnern“.
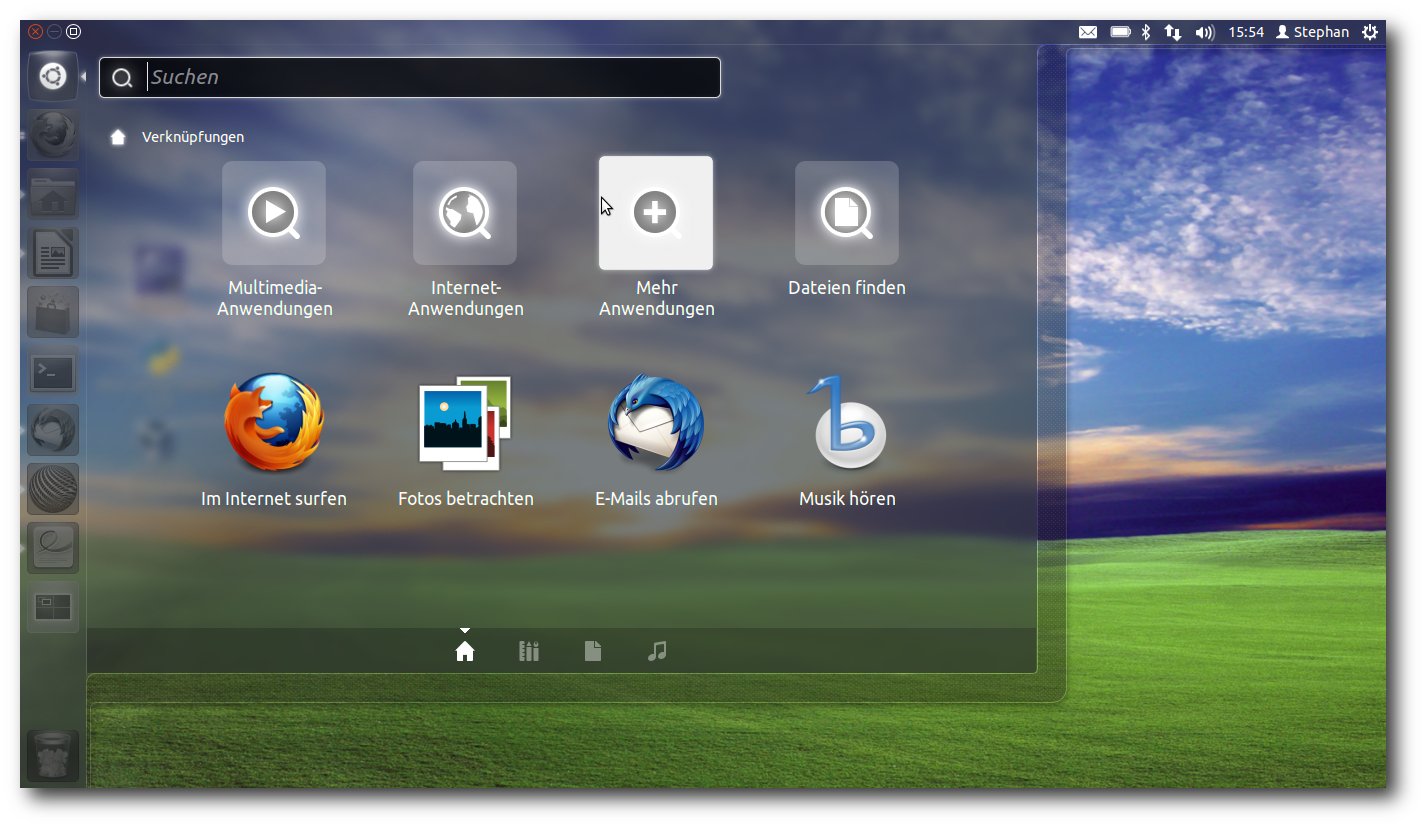
Übersicht über die Dash.
Der Starter – Launcher
Der Starter ist ein zentrales Instrument zur Orientierung auf der
Unity-Oberfläche. Mit Hilfe des Starters greift man schnell auf
Programme, Dateien und das Unity-Menü (Dash) zu.
Er wurde für kleine Desktops entwickelt und dient der leichten
Übersicht auf der Oberfläche.
Anders als bei bekannten Docks ist der Starter schon vollständig
vorkonfiguriert, sodass nur die enthaltenen Programme
ausgetauscht, entfernt und neue hinzugefügt werden können.
Über einen Rechtsklick auf ein Programm im Starter kann der Benutzer
bestimmen, ob das Programm geschlossen, gestartet oder im Starter
verankert werden soll.
Das Unity-Menü – Dash
Zum Unity-Menü gelangt man über einen Klick auf das Ubuntu-Symbol
oberhalb des Starters (ab 11.10 innerhalb desselben). Das Unity-Menü
bietet die Möglichkeit, auf Programme, Ordner und Dateien thematisch
und alphabetisch sortiert zugreifen zu können.
Die Suchfunktion durchsucht Dokumente und Programme, ob diese thematisch,
namentlich oder inhaltlich (bei Textdateien) in das Suchraster passen. Die
Größe der Dash kann entweder per Shelleingabe (Ubuntu 11.04) oder
ab Ubuntu 11.10 über Icons geändert werden.
Programme und Ordner
Die Unity-Oberfläche orientiert sich stark an modernen Oberflächen,
ähnlich wie bei den
Mac-OS-X-Betriebssystemen.
Wie bereits beschrieben sind die Menüleisten der Anwendungen nicht
wie gewohnt im Programmfenster, sondern am oberen Rand zu finden.
Eine weitere Neuerung ist, dass die Größe der Programmfenster über
das Schieben an den linken, rechten und oberen Rand teilweise
oder vollkommen maximiert wird.
Das Software-Center
Ab Ubuntu 11.10 wurde der Paketmanager Synaptic komplett durch das
Software-Center ersetzt. Das Nachinstallieren von Synaptic ist
trotzdem möglich.
Das Software-Center bietet vor allem für Einsteiger eine
übersichtliche Oberfläche. Die Suche nach geeigneten Programmen
wird durch Icons und Programmbeschreibungen deutlich verbessert.
Es ist möglich, nach einer Installation das installierte Programm
direkt im Launcher als Standard zu integrieren. Über das Tool
quickly können nun auch eigene Programme in die Ubuntu-Repositories
geladen werden. Weitere Informationen findet man auf der Developer
Seite von Ubuntu [1].
Die Systemeinstellungen
Neu ist ab Ubuntu 11.10 die zentrale Verwaltung der
Systemeinstellungen. Über diese gelangt man zu den wichtigsten
Konfigurationen.
Man findet die Systemeinstellungen im Sitzungsmenü in der
rechten oberen Ecke.
Weitere Neuerungen
Programme wie Mozilla Firefox, Evolution (Ubuntu 11.04), Thunderbird
(Ubuntu 11.10) und Banshee sind in Unity vollständig integriert.
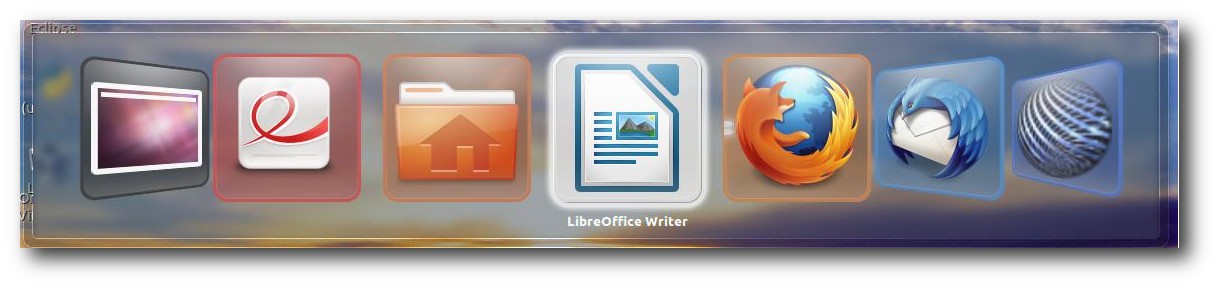
Darstellung des Umschaltens bei Unity-3D.
Durch diese Integration wird beispielsweise eine neue E-Mail im
Message-Menü blau dargestellt. Mit Ubuntu 11.10 kann man die Unity-Oberfläche auch auch ohne
3D-Beschleunigung einsetzen.
Unity-2D verfügt zwar über die gleichen Tools wie Unity-3D, jedoch
wurden die grafischen Effekte, bei denen man eine 3D-Beschleunigung
braucht, herausgenommen.
So wird etwa der Starter, die Dash und das Umschalten per Alt und
Umschalt-Taste klobig dargestellt.
Zusammenfassung
Die Unity-Oberfläche ist, ähnlich wie die GNOME-Shell, ein
grafischer Aufsatz auf die GNOME 2.3 und GNOME 3.0 Oberfläche.
Außerdem verwendet Unity, um die vielen Grafikeffekte verarbeiten zu
können, den Fenstermanager Compiz.
Somit macht die Kombination aus GNOME-Oberfläche, Compiz und
Canonical als Entwicklerteam Unity bedienungsfreundlich und fit für
die Zukunft, besonders um proprietären Betriebssystemen die Stirn zu
bieten.
Diese Bedienungsfreundlichkeit geht jedoch zu Lasten von
Ubuntu/Linux-Nutzern, die die neue Oberfläche als zu umständlich
betrachten.
Möchte
man beispielsweise tiefgreifende Änderungen an Unity
vornehmen, muss man Dconf oder CompizConfig benutzen [2].
Außerdem ergeben sich im Detail Fehler, wie das fehlende Hinzufügen
von eigens erstellten wechselnden Hintergründen
(Slideshow-Wallpapers).
Falls man Hilfe, Informationen oder aktuelle Neuigkeiten zu Ubuntu
und Unity sucht sind die Internetseiten von „OMG! Ubuntu!“ [3] und „ubuntuusers“ [4]
hilfreich.
Links
[1] http://developer.ubuntu.com/
[2] http://askubuntu.com/questions/29553/how-can-i-configure-unityubuntuusers.de
[3] http://www.omgubuntu.co.uk/
[4] http://ubuntuusers.de
| Autoreninformation |
| Stephan Scholz
arbeitet seit 2010 ausschließlich mit Linux bzw.
Ubuntu. Er interessiert sich für innovative Linux-Technologien.
|
| |
Diesen Artikel kommentieren
Zum Index
von Mathias Menzer
Basis aller Distributionen ist der Linux-Kernel, der fortwährend weiterentwickelt wird. Welche Geräte in einem halben Jahr unterstützt werden und welche Funktionen neu hinzukommen, erfährt man, wenn man den aktuellen Entwickler-Kernel im Auge behält.
Linux 3.2
Mit der ersten Vorabversion von Linux 3.2 [1] bekam der Kernel auch gleich einen neuen Namen: Auf die „Divemaster Edition“ folgt „Saber-toothed Squirrel“ (in etwa: Säbelzahn-Eichhörnchen). Der Patch, der ein 3.1-Archiv auf 3.2-rc1 befördert, verirrte sich nicht nur in den falschen Pfad, er wurde nicht im Verzeichnis /testing sondern direkt unter v3.0 [2] veröffentlicht, und war diesmal verhältnismäßig groß. Das lag jedoch an Änderungen der Struktur des Kernel-Quellcodes, in der ganze Bäume verschoben wurden. Während die Versionsverwaltung Git damit problemlos zurecht kommt und das Verschieben innerhalb des Dateibaums abbilden kann, müssen die betroffenen Dateien im Patch einmal gelöscht und am neuen Ort wieder erstellt werden. Diese Aufräumarbeiten dauern schon länger an und sollen die Struktur übersichtlicher machen. Prominent waren das Zusammenziehen der TTY-Umgebung (die Umsetzung der Terminal-Schnittstelle) mit den Character Devices (zeichenorientierten Geräten) (siehe „Der Januar im Kernelrückblick“, freiesMagazin 02/2011 [3]), diesmal kamen der Bereich der Netzwerktreiber, die ARM-Architektur und der Zweig von User Mode Linux [4] dran. Die bedeutendste Neuerung in Torvalds Augen ging in der Masse dieser Umbauarbeiten unter: Änderungen an der virtuellen Speicherverwaltung [5], die die Steuerung von Schreibvorgängen auf Datenträger verbessern und dadurch für die meisten Endanwender spürbar sein sollen.
Linux 3.2-rc2 [6] konnte wieder im korrekten Pfad gefunden werden, nachdem Torvalds seine Skripte für die Veröffentlichung des Kernels korrigiert hatte. Es wurden insbesondere die Komponenten des freien Nouveau-Treibers für NVIDIA-Grafikchips mit Korrekturen bedacht und Erweiterungen an der Architektur-Unterstützung für Motorolas 6800-Prozessorfamilie vorgenommen. Dazu kommen Ergänzungen der Dokumentation für den DRM-Bereich (Direct Rendering Manager) und das Kernel-Testskript ktest.pl.
Den -rc3 [7] legte Torvalds dann pünktlich zu Thanksgiving auf. Fiel der -rc2 noch vergleichsweise klein aus, bietet der -rc3 ein eher gewohntes Bild. Die Änderungen verteilen sich einigermaßen gleichmäßig über den ganzen Kernel, der DRM-Bereich sticht mit verschiedenen Korrekturen an den Treibern für Intel- und AMD/ATI-Grafik ein klein wenig hervor. Der WLAN-Treiber iwlwifi sorgte in -rc2 noch für eine Kernel Panic [8], wenn der WLAN-Chip abgeschaltet und der Treiber entladen werden sollte. Eine Änderung der Reihenfolge, in der die einzelnen Komponenten des Systems deaktiviert werden, soll das Problem nun beheben.
Waren die Vorabversionen 2 und 3 mit einer eher steigenden Anzahl an Änderungen behaftet, so deutet Linux 3.2-rc4 [9] auf eine Beruhigung der Entwicklung hin. Entsprechend sind die Änderungen auch überschaubar. An der ARM-Architektur selbst wurde abermals gearbeitet, ebenso an Samsungs auf ARM basierendem System-on-Chip-Plattform Exynos bzw. deren Grafik-Treiber. Auch btrfs wurde mit Fehlerkorrekturen bedacht. Vielleicht legt Torvalds uns dieses Jahr wieder einen Weihnachtskernel unter den Christbaum, da jedoch noch einige Probleme offen sind, lässt sich das nicht mit Sicherheit sagen.
ASPM
Ein langes Leiden begann mit Kernel 2.6.38, als ein Problem mit dem Active State Power Management (ASPM) [10] des PCI-Express-Bus auftrat. Betroffene Notebook-Nutzer mussten fortan mit drastisch verkürzten Laufzeiten leben, da die PCIe-Umgebung sich nicht mehr in den Schlaf schicken ließ.
Ursache war eine Änderung, die eigentlich Probleme in dem Fall verhindern sollte, dass das BIOS die Verwendung von ASPM zu unterbinden sucht. Hierbei wird eine Einstellung ausgelesen, die jedoch in vielen Fällen falsch gesetzt ist und somit bewirkt, dass ASPM, obwohl eigentlich verfügbar, deaktiviert wird. Die Folge ist ein erhöhter Energiebedarf des PCIe-Busses, da er dauerhaft aktiviert bleibt.
Zwischenzeitlich wurde ein Patch [11] auf Basis des ursprünglichen Übeltäters vorgestellt, der jedoch ASPM nur dann wirklich deaktiviert, wenn die vollständige Kontrolle über PCIe beim Betriebssystem liegt und es damit die eigenen Mechanismen zum Energiemanagement nutzen kann anstelle des in PCIe integrierten ASPM. Das Ubuntu Kernel Team testet den Patch mittels eines angepassten Kernels für Ubuntu 11.10 und die Entwicklungsversion 12.04 [12].
Links
[1] https://lkml.org/lkml/2011/11/7/562
[2] https://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v3.0/
[3] http://www.freiesmagazin.de/freiesMagazin-2011-02
[4] https://de.wikipedia.org/wiki/User_Mode_Linux
[5] https://de.wikipedia.org/wiki/Virtuelle_Speicherverwaltung
[6] https://lkml.org/lkml/2011/11/15/237
[7] https://lkml.org/lkml/2011/11/23/578
[8] http://de.wikipedia.org/wiki/Kernel_panic
[9] https://lkml.org/lkml/2011/12/1/517
[10] http://en.wikipedia.org/wiki/Active_State_Power_Management
[11] https://lkml.org/lkml/2011/11/10/467
[12] https://wiki.ubuntu.com/Kernel/PowerManagement
| Autoreninformation |
| Mathias Menzer (Webseite)
hält einen Blick auf die Entwicklung des Linux-Kernels und erfährt frühzeitig Details über interessante Funktionen.
|
| |
Diesen Artikel kommentieren
Zum Index
von Jochen Schnelle
Python ist heutzutage eine feste Größe unter den Programmiersprachen –
auch, wenn es um das Schreiben von Webanwendungen geht. Wer eine solche
programmiert, möchte früher oder später auch Daten vom Nutzer eingeben
lassen. Hier kommen dann HTML-Formulare ins Spiel. Im Rahmen dieses
Artikels werden fünf verschiedenen Frameworks für Python vorgestellt,
welche den Umgang mit diesen Formularen erleichtern sollen.
Warum ein Formular-Framework?
Zugegebenermaßen ist das Erstellen eines Formulars in HTML kein
Hexenwerk, sondern vergleichsweise sogar einfach. Ein Framework dient
aber nicht alleine zur Erstellung des Formulars aus Python heraus,
sondern übernimmt direkt auch noch die Typenkonvertierung und
Validierung der Eingaben, was für den Programmierer äußerst praktisch
ist.
Gibt man Daten in ein HTML-Formular ein, werden diese vom Browser an
den Server bzw. die Anwendung als Text übertragen, sodass in der
Anwendung erst einmal alles als String ankommt. Nun gibt es aber eine
Vielzahl von Fällen, bei der als Eingabe beispielsweise eine Zahl erwartet
wird, wie z. B. beim Alter in Jahren oder einer Hausnummer. Hier führen
die Frameworks direkt eine Typenprüfung und -konvertierung von String
nach Integer durch – oder melden einen Fehler, wenn der eingegebene
Wert keine ganze Zahl ist. Somit kann das unter Umständen recht
aufwendige Prüfen und Konvertieren „von Hand“ entfallen. Alle
Frameworks stellen solche Felder und Prüfungen auch für
Gleitkommazahlen, Datum usw. bereit.
Hat man alle Daten vom Nutzer erhalten und erfolgreich konvertiert,
stellen alle Frameworks als weiteren Schritt der Validierung eine
Überprüfung der Daten bereit. In deren Rahmen wird getestet, ob z. B.
alle Pflichtfelder ausgefüllt wurden. Somit kann auch dafür die
händische Prüfung entfallen.
Sollte die Konvertierung oder Validierung fehlschlagen, so erzeugen
alle Frameworks direkt eine Liste von Fehlern, zumeist unterteilt in
den Feldnamen und den zugehörigen Fehler. Diese kann dann angezeigt
werden, zusammen mit der Aufforderung an den Nutzer, das Formular
erneut und richtig auszufüllen.
Ein weiterer Vorteil ist, dass die meisten Frameworks automatisch
ausklappbare Auswahlfelder generieren können, sodass das lästige
Tippen von <option>…</option> entfällt.
Client-seitige vs. Server-seitige Validierung
Natürlich können in ein HTML-Formular eingegebene Daten auch
Client-seitig via Javascript geprüft werden, diverse
Javascript-Frameworks stellen hierfür die benötigten Funktionen bereit.
Nichtsdestotrotz sollte immer zusätzlich auch eine serverseitige
Validierung erfolgen, da der HTML-Header, welcher die gesendeten
Formulardaten enthält, auch nach der clientseitigen Validierung noch
manipuliert werden kann. Abgesehen davon ist auf dem Server die
Konvertierung der Daten so oder so erforderlich. Und dieser Vorgang ist
bei allen vorgestellten Frameworks mit der Validierung verbunden.
Aufbau des Artikels
Im Rahmen dieses Artikels werden fünf verschiedene Frameworks für
Python zum Umgang mit HTML-Formularen vorgestellt: Deform, WTForms,
FormAlchemy, Fungiform und Flatland. Dabei handelt es sich in der Tat
um eine Vorstellung, nicht etwa um einen Vergleichstest oder
Ähnliches.
Mit jedem Framework sollen zwei Formulare erstellt werden. Dabei
kommen verschiedene Feldtypen und Validatoren zum Einsatz. Das erste
Formular heißt UserData und enthält drei Felder: Name, Geburtstag
und Geschlecht. Der Name darf beliebig sein, außer „admin“ oder
„superuser“. Das Feld Geschlecht soll ein Auswahlfeld mit den
Auswahlmöglichkeiten „männlich“ und „weiblich“ sein, das Feld
Geburtstag soll optional sein. Im zweiten Formular namens LoginForm
soll ein einfaches Login-Formular erstellt werden. Auch hier gibt es
drei Felder: E-Mail-Adresse, Passwort und Wiederholung – alles
Pflichtfelder. Die eingegebene E-Mail Adresse soll einer rudimentären
Prüfung unterzogen werden, nämlich ob ein @-Zeichen darin vorkommt.
Ein weiterer Validator soll sicherstellen, dass die Eingaben für
Passwort und Wiederholung identisch sind.
Danach wird innerhalb einer Python-Shell ein wenig mit den Frameworks
und Formularen experimentiert. Dabei wird z. B. testweise ein
HTML-Formular aus der Vorlage generiert, Daten übergeben und eine
Validierung durchgeführt.
Am Ende des Artikels werden noch einige Framework-unabhängige Hinweise
gegeben, wie die Programme innerhalb einer Webanwendung eingebaut und
genutzt werden können.
Alle Beispiele sind unter Python 2.6 und Python 2.7 getestet, die
getestete Versionsnummer der Frameworks ist jeweils im zugehörigen
Abschnitt angegeben.
Gemeinsamkeiten
Es gibt in der Tat ein paar Gemeinsamkeit der Kandidaten. So arbeiten
alle fünf Frameworks intern mit Unicode-Daten – was unter Python auch
üblich ist. Dies bedeutet aber auch, dass die vom HTML-Formular
gesendeten Daten zuerst nach Unicode dekodiert werden müssen, da eine
Webseite immer kodierte Daten schickt (z. B. UTF-8, ISO-8815-1 usw.).
Einige der Frameworks haben bereits einen eingebauten Validator zur
Prüfung einer E-Mail-Adresse. Dieser ist aber in allen Fällen wirklich
minimalistisch, d. h. es wird nur geprüft, ob ein @-Zeichen vorkommt,
gegebenenfalls auch noch, ob ein Punkt zur Abgrenzung der
Top-Level-Domain vorhanden ist. Wer also ein HTML-Formular mit Eingabe der
E-Mail Adresse schreiben möchte und dann auch E-Mails an diese Adresse
versenden will sollte auch noch weitergehende Prüfungen
implementieren, wie z. B. das Senden einer Bestätigungsmail.
Alle Frameworks stellen HTML-Code nach der Version 4 dar. HTML 5,
welches ja auch bei Formularelementen einige Neuerungen bietet, kommt
nicht zum Einsatz. Eine Python-3-Version gibt es scheinbar für keines
der Frameworks, jedenfalls gibt es keinen offensichtlichen Hinweis
darauf. Und zu guter Letzt sei noch erwähnt, dass alle fünf Kandidaten
unter einer Open-Source-Lizenz stehen.
Deform
Das erste vorgestellt Framework ist Deform [1],
welches in
Rahmen des Pylons-Projekts entwickelt wird. Deform ist dabei aber
komplett unabhängig von Pylons und Pyramid und kann auch in
Kombination mit anderen Webframeworks genutzt werden.
Für diesen Artikel wird die aktuelle und stabile Deform-Version 0.9.3 verwendet.
Bei der Installation werden drei weitere Abhängigkeiten mit
installiert, nämlich Colander [2],
Peppercorn [3] und
Chameleon [4]. Während der Nutzer mit den
letzten beiden Modulen nicht in direkten Kontakt kommt, wird von
Colander direkt gebraucht gemacht, nämlich zum Anlegen des
Formularschemas.
Sowohl Deform als auch Colander sind vollständig und umfassend
dokumentiert.
Klassen für Formulare mit Deform
Die Definition der HTML-Formulare erfolgt, wie auch für die anderen
Frameworks, in Klassen.
Die beiden Klassen sehen hier so aus:
# -*- coding: utf-8 -*-
import colander
from deform.widget import SelectWidget, CheckedPasswordWidget
class UserData(colander.MappingSchema):
def none_off(value):
if value in ('admin','superuser'):
return False
else:
return True
name = colander.SchemaNode(colander.String(),
validator = colander.Function(none_off,
message = u'nicht erlaubter Benutzername'))
birthday = colander.SchemaNode(colander.Date(),
missing = '0000-00-00')
gender = colander.SchemaNode(colander.String(),
widget = SelectWidget(values=(
(u'männlich',u'männlich'),(u'weiblich',u'weiblich'))))
class LoginForm(colander.MappingSchema):
email = colander.SchemaNode(colander.String(),
validator = colander.Email(
msg = u'Dies ist keine gültige E-Mail Adresse'))
password = colander.SchemaNode(colander.String(),
widget = CheckedPasswordWidget())
Listing: deform_forms.py
Als Erstes erfolgen die notwendigen Importe. Dabei wird zuerst
Colander importiert, welches, wie oben bereits erwähnt, zur Definition
der Struktur dient. Des Weiteren werden noch zwei „Widgets“
importiert, welche später für die Darstellung von bestimmten
Formularfeldern verantwortlich sind.
Wie zu sehen ist, ist jedes Formularfeld ein SchemaNode, also ein
Knoten des Gesamtschemas. Für jeden Knoten ist wiederum ein Datentyp
festgelegt, hier in diesen Beispielen wird nur String und Data
verwendet. Bei den Feldern gender und password wird zusätzlich
noch ein Widget angewendet. Im ersten Fall dient dieses dazu, ein
Auswahlmenü zu generieren, im zweiten Fall zum Darstellen einer
Passworteingabe, inklusive Wiederholung. Gerade das letzte Widget
namens CheckPasswordWidget ist recht praktisch, da durch dessen
Einsatz nur ein Passwortfeld angelegt werden muss. In den anderen
Frameworks sind das Passwort und die Wiederholung eigene Felder.
Des Weiteren kommen hier auch Validatoren zum Einsatz. Diese sind Teil
der Klasse colander.SchemaNode und müssen nicht separat importiert
werden. Über msg = '...' können innerhalb der Validatoren eigene
Fehlermeldungen festgelegt werden. In der Klasse UserData kommt
weiterhin ein selbst geschriebener Validator zum Einsatz. Dies ist die
innerhalb der Klasse definierte Funktion none_of, welche prüft, ob
der in das Formularfeld eingegebene Benutzername nicht in der Liste
der nicht erlaubten Namen enthalten ist. Per Voreinstellung sind alle
Felder als Pflichtfelder gekennzeichnet, d. h. es wird eine Eingabe
erwartet. Soll ein Feld optional sein, so wie hier das Geburtsdatum,
dann ist dass Argument missing zu hinterlegen, wie auch hier im Feld
birthday. Damit wird ein Vorgabewert festgelegt, der die fehlende
Eingabe ersetzt.
Deform in der Konsole
Im Folgenden werden einige „Versuche“ mit Deform in einer Python-Shell
durchgeführt. Wie bereits erwähnt wurde bis jetzt nur die Struktur der
Formulare mit Hilfe von Colander festgelegt. Zum Überführen in eine
Klasse für ein Formular muss zuerst noch die Basisklasse von Deform
für alle Formulare importiert werden:
>>> from deform import Form
Dann werden die beiden Klassen aus Listing 1 importiert:
>>> from deform_forms import UserData, LoginForm
Jetzt kann eine Formularklasse abgeleitet werden. Dabei können direkt
die gewünschte action für das Formular sowie eine Senden-Schaltfläche
hinzugefügt werden:
>>> ud = Form(UserData(), action = '/foo', buttons = ('submit',))
Die Angabe von action und buttons ist dabei optional. Das
HTML-Formular kann nun gerendert werden:
>>> ud.render()
u'<form id="deform" action="/foo" method="POST" [...] <li title="" id="item-deformField1"> <!-- mapping_item --><label> <class="desc" title="" for="deformField1">Name<span class="req" id="req-deformField1">*</span></label> <input type="text" name="name" value="" id="deformField1"/> [...] </form>'
Die Ausgabe ist stark gekürzt, weil der HTML-Code sonst den Rahmen des
Artikels überschreiten würde. Wie zu sehen ist, generiert Deform direkt
das komplette HTML, also inklusive <form>-Tags etc. Auch wenn es im
obigen Beispiel nicht zu sehen ist, bindet Deform auch direkt
Javascript-Code mit ein. Die passenden Skripte werden bei der
Installation des Frameworks mit kopiert und liegen im
Installationsverzeichnis von Deform im Unterverzeichnis /scripts.
Ebenso bringt Deform direkt passende Stylesheets mit, diese liegen im
Unterverzeichnis /css. Der Einsatz der Skripte und der Stylesheets
in der eigenen Applikation ist aber optional, die gerenderten
Formulare können auch ohne Weiteres allein genutzt werden.
Als nächstes werden Daten an das Formular
übergeben und diese dann validiert. Die Daten erwartet Deform als
Tuple von 2er-Tuplen, was übrigens von den meisten Webframeworks
standardmäßig auch geliefert wird:
>>> mydata = (('name','Otto'),('gender',u'männlich'),('birthday','1977-1-1'))
>>> ud.validate(mydata)
{'gender': u'm\xe4nnlich', 'birthday': datetime.date(1977, 1, 1), 'name': u'Otto'}
Und noch eine nicht erfolgreiche Validierung:
>>> mydata = (('name','admin'),('gender',u'männlich'),
('birthday','1977-1-1'))
>>> ud.validate(mydata)
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>
File "/usr/local/lib/python2.6/dist-packages/deform-0.9.3-py2.6.egg/deform/field.py", line 519, in validate
raise exception.ValidationFailure(self, cstruct, e)
deform.exception.ValidationFailure
Hier geht Deform einen etwas anderen Weg als die anderen Frameworks:
Bei erfolgreicher Validierung wird nicht True zurückgeliefert,
sondern die validierten Daten als Dictionary. Im Falle einer
fehlerhaften Validierung wird eine Exception geworfen. Möchte man die
Fehlermeldungen sehen, so muss man erneut die render()-Methode der
Formularklasse aufrufen. Der HTML-Code enthält dann alle Fehlermeldungen:
>>> ud.render()
[...]
class="error" id="error-deformField1">nicht erlaubter Benutzername</p>
[...]
Da Deform bei Nicht-Validierung immer einen Fehler wirft,
muss in einer Applikation natürlich immer ein try...except-Block
genutzt werden. Ein Beispiel dazu ist in der Dokumentation zu finden [5].
Weitere Funktionen
Neben den hier gezeigt Feldtypen kennt Deform natürlich auch noch eine
Reihe weiterer Felder, z. B. für Integerwerte. Außerdem bietet das
Framework unter Einsatz von Javascript auch die
Möglichkeit der
automatischen Vervollständigung von Eingaben in Felder [6].
Durch den Einsatz von Colander für die Definition des Schemas ist es
auch ohne weiteres möglich, komplexer und verschachtelte
Datenstrukturen darzustellen.
WTForms
Das nächste Framework ist WTForms [7],
welches in der Version 0.6.2 vorliegt. Das Framework ist als stabil
und für den produktiven Einsatz bereit gekennzeichnet.
WTForms beansprucht für sich selbst, ein „einfaches“ Framework zu
sein, mit dem man schnell und mit wenig Aufwand Formulare erstellen kann.
Weiterhin ist das Framework so
gestaltet, dass sich damit generierte Formularelemente ohne Probleme in Templates einfügen lassen, ohne dass darin
größere Änderungen von Nöten sind.
Die Dokumentation von WTForms [8]
ist vollständig. Der Umfang ist kompakt,
verständlich geschrieben und gut strukturiert, sodass diese schnell
gelesen ist.
WTForms hat bei der Installation keine Abhängigkeiten, d. h. es werden
nur die Dateien des Frameworks selbst installiert.
Formulare mit WTForms
Die beiden Formularen sehen mit WTForms so aus:
# -*- coding: utf-8 -*-
from wtforms import Form, TextField, SelectField, DateField, \
PasswordField, SubmitField, validators
class UserData(Form):
name = TextField(u'Name',
[validators.Required(),validators.NoneOf(
('admin','superuser'))])
birthday = DateField(u'Geburtsdatum',[validators.Optional()])
gender = SelectField(u'Geschlecht',
choices=[(u'männlich',u'männlich'),
(u'weiblich',u'weiblich')])
send = SubmitField(u'Senden')
class LoginForm(Form):
email = TextField(u'E-Mail Adresse',
[validators.Email()])
pass1 = PasswordField(u'Password',
[validators.Required(), validators.EqualTo('pass2',
message=u'Passwörter müssen übereinstimmen')])
pass2 = PasswordField(u'Password Wiederholung')
send = SubmitField(u'Senden')
Listing: wtforms_forms.py
Wie
zu sehen ist, erfolgen alle notwendigen Importe direkt aus der
obersten
Ebene des Moduls heraus. Importiert werden Form – welches
die Basisklasse für Formulare ist, diverse Feldelemente sowie die
enthaltenen Validatoren.
Die Instanzen der Formulare leiten sich von vordefinierten
Feldtypen ab, wobei die weiteren Angaben alle optional sind.
Nichtsdestotrotz ist es empfehlenswert, zumindest immer ein Label
anzugeben, wie im obigen Beispiel auch. Dieses ist später beim Anzeigen
des Formular nützlich. Das Label ist dabei das erste Argument. Als
zweites Argument kann eine Liste von anzuwendenden Validatoren
übergeben werden, dann können weitere optionale Elemente folgen. Im
Falle des Felds gender ist dies z. B. choices, welches die Optionen
für die Auswahlliste enthält. WTForms erwartet die Optionen als Liste
von Tupeln, wobei das erste Element des Tupels der Name der Option
ist, das zweite die Option, welche in der Liste angezeigt wird. Das
erste und zweite Element müssen also nicht gleich sein. Weiterhin ist die „Submit“-Schaltfläche in WTForms ein
eigenes Formularelement.
Im obigen Beispiel werden nur Validatoren verwendet, welche WTForms
bereits mitbringt. Da es von diesen eine recht umfangreiche Auswahl
gibt, ist eine Definition von eigenen Validatoren nicht notwendig –
aber grundsätzlich natürlich möglich. Im Feld name wird mit Hilfe
von NoneOf geprüft, ob die folgenden Begriffe nicht gleich der
Eingabe sind. birthday ist als optional gekennzeichnet, d. h. erfolgt
hier keine Eingabe, validiert das Formular trotzdem. Falsche Eingaben
führen natürlich trotzdem zu einem Fehler. Der Validator EqualTo im
Feld pass1 prüft, ob die Eingabe identisch mit der im Feld pass2
ist. Außerdem wird hier mit message=... eine eigene Fehlermeldung
hinterlegt, welche die standardmäßig hinterlegte (englischsprachige)
Fehlermeldung ersetzt.
WTForms in der Python-Shell
Nach dem obligatorischen Import der Klassen mit den Formularen
>>> from wtforms_forms import UserData, LoginForm
wird eine eigene Klasse ud von UserData abgeleitet:
>>> ud = UserData()
Das Rendern der Formularfelder ist dabei denkbar einfach. Dazu wird
einfach das darzustellende Feld der Klasse aufgerufen:
>>> ud.name()
u'<input id="name" name="name" type="text" value="" />'
>>> ud.send()
u'<input id="send" name="send" type="submit" value="Senden" />'
Im Gegensatz zum weiter oben gezeigten
Deform – und auch im Gegensatz
zu den noch folgenden FormAlchemy und Fungiform – rendert WTForms
nicht das ganze Formular, sondern nur die jeweiligen Felder. Die
<form>-Tags inklusive action=... müssen also manuell gesetzt werden.
Wie bei der Klassendefinition der Formulare bereits erwähnt, können die
Label separat gerendert werden:
>>> ud.name.label()
u'<label for="name">Name</label>'
Der Vorteil ist, dass später so mehr Flexibilität bei der Darstellung
in der Webapplikation besteht, dafür aber auch mehr Code-Zeilen nötig
sind.
Als Nächstes werden direkt Daten an das Formular übergeben und die
Validierung aufgerufen:
>>> ud = UserData(name='Otto',birthday='1977-1-1',gender=u'männlich')
>>> ud.validate()
True
Da alle Daten im Gültigkeitsbereich liegen, validiert das Formular
natürlich. Im folgenden Beispiel wird für name ein nicht gültiger
Wert übergeben, sodass das Formular nicht validiert:
>>> ud = UserData(name='admin',birthday='1977-1-1',gender=u'männlich')
>>> ud.validate()
False
Die Fehler können wie folgt aufgerufen werden:
>>> ud.errors
{'name': [u"Invalid value, can't be any of: admin, superuser."]}
Da keine eigene Fehlermeldung für diese Validierung in der Klasse
hinterlegt wurde, gibt WTForms die Standardfehlermeldung aus. Die
Fehler stehen übrigens in einer Liste, weil ein Feld durchaus auch
mehrere Fehler enthalten kann, je nachdem, wieviele und welche
Validatoren hinterlegt sind.
Weiteres zu WTForms
WTForms bietet neben den hier gezeigten Feldern auch alle anderen
gängigen Feldtypen. Das Anlegen eigener, neuer Feldtypen ist ebenfalls
möglich. Hinweise dazu findet man in der offiziellen Dokumentation.
Des Weiteren gibt es einige offizielle Erweiterungen
zu WTForms [9].
Diese erlauben unter
anderem die vereinfachte Nutzung von WTForms in Kombination mit
Django, SQLAlchemy und der Google-App-Engine.
FormAlchemy
FormAlchemy [10] trägt von allen
hier vorgestellten Programmen die höchste Versionsnummer, nämlich
1.4.1 und ist natürlich entsprechend als „stable“ gekennzeichnet. Wie
der Name vermuten lässt, gibt es eine Verbindung zu SQLAlchemy [11],
einem der populärsten Object-Relational-Mapper für SQL-Datenbanken
unter Python. FormAlchemy kann nämlich für
SQLAlchemy-Modelle bzw. gemappte Klassen direkt HTML-Formulare
erstellen. Dies ist sehr praktisch, wenn man seine Daten ohnehin
über diesen ORM abruft und speichert, zumal FormAlchemy
Formulareingaben auch direkt wieder in der Datenbank speichern kann.
Aber das Framework kann auch Formulare „konventionell“ erstellen, so
wie die anderen hier vorgestellten Programme auch. Dies wird im Rahmen
dieses Artikels behandelt. Der einzige Unterschied zur direkten
Anbindung an SQLAlchemy ist übrigens, dass man bei „manuellen“
Formularen die Definition händisch vornehmen muss, alle anderen
Schritte sind gleich.
Bei der Installation werden drei Abhängigkeiten mit
installiert, nämlich WebOb [12],
Webhelpers [13],
Tempita [14] und SQLAlchemy.
Klassen für das Formular
Bei der händischen Definition von Formularen werden auch in
FormAlchemy Klassen verwendet. Im Gegensatz zu den anderen Frameworks
sind diese hier aber normale New-Style-Pythonklassen, d. h. es wird
keine generische Basisklasse für Formulare zugrunde gelegt. Das
Framework kennt natürlich auch verschiedene Datentypen, im FormAlchemy
als „types“ bezeichnet. Und es gibt eine Reihe von eingebauten
Validatoren, wie z. B. required(). Das Anlegen eigener Validatoren ist auch möglich. Außerdem
kann man in FormAlchemy bei der Definition eines Felds in einem
Formular optional den „Renderer“ festlegen, also wie das Feld später
dargestellt wird. Natürlich sind hier alle Feldtypen mit sinnvollen
Voreinstellungen vorbelegt, trotzdem besteht hier noch bei Bedarf die
Flexibilität, auch Spezialfälle abbilden zu
können.
Die Definition der Klassen sieht in FormAlchemy
so aus:
# -*- coding: utf-8 -*-
from formalchemy import Field, types
from formalchemy.validators import email, length, ValidationError
class UserData(object):
def check_name(value,field):
if field.value in ['admin','superuser']:
raise ValidationError(u'Verbotener Benutzername')
name = Field(type=types.String).label(u'Name').required()\
.validate(check_name)
birthday = Field(type=types.Date).label(u'Geburtstag')
gender = Field(type=types.String).label(u'Geschlecht').dropdown(
options=[
(u'männlich', u'männlich'), (u'weiblich',u'weiblich')])
class LoginForm(object):
def pass2_validator(value, field):
if field.parent.pass1.value != value:
raise ValidationError(u'Keine Übereinstimmung.')
myemail = Field(type=types.String).required().validate(email)
pass1 = Field(type=types.String).password().required()
pass2 = Field(type=types.String).password().required()\
.validate(pass2_validator)
Listing: FormAlchemy_forms.py
Zu Beginn gibt es die obligatorischen Importe, dann folgt die
Definition der Klasse UserData. Wie zu sehen ist, ist jedes
Formularelement vom Typ Fields, die Festlegung von type=... ist
Pflicht, alle folgenden Punkte optional. label(...) definiert ein
Label, required() legt fest, ob ein Feld ein Pflichtfeld ist,
validate(...) legt die zusätzlichen Validatoren fest.
In der Klasse UserData wird die Funktion check_name
definiert, welche dann im Feld name als Validator für den Benutzernamen eingesetzt wird.
Die Klasse Field kennt übrigens auch ein Attribute name, welches
aber beim manuellen
Schreiben von Klassen nicht verwendet werden darf,
da sonst später ein Fehler beim Anlegen eines FieldSet geworfen wird. FormAlchemy legt den Namen selber fest, wobei dieser
identisch ist mit der aus Field angelegten Klasse, im Falle von
UserData also name, birthday und gender.
Interessent ist bei gender, dass Auswahlmenüs erst als normales
Feld, hier vom Typ String, definiert werden und erst dann festgelegt wird,
dass es eine Dropdown-Liste sein soll. Bei Checkboxen und Radiobuttons
geschieht dies auf gleiche Art und Weise. Im zweiten Formular
LoginForm wird über password() bestimmt, dass dieses Feld ein
Passwortfeld ist. Weiterhin wird in dieser Klasse zuerst eine eigene
Funktion pass2_validator definiert, welche später bei pass2 als
eigener Validator dient.
Tests in der Python-Konsole
Um FormAlchemy noch näher kennenzulernen wird eine Python-Konsole
aufgerufen, um ein bisschen mit den Formularen
zu experimentieren.
Dazu werden aus FormAlchemy_forms.py beide Klassen importiert.
Außerdem wird noch FieldSet aus FormAlchemy benötigt.
>>> from formalchemy_forms import UserData, LoginForm
>>> from formalchemy import FieldSet
Mit Hilfe des FieldSet wird nun die eigentliche Klasse erzeugt, mit der
das HTML-Formular später generiert wird und mit deren Hilfe auch
Formulardaten validiert werden können.
>>> ud = FieldSet(UserData)
Der einfache Aufruf von userdata zeigt die enthaltenen Felder:
>>> ud
<FieldSet with ['birthday', 'gender', 'name']>
Das Generieren des HTML-Formulars geschieht über den Aufruf von
render():
>>> ud.render()
u'<div><label class="field_req" for="UserData--name">Name</label><input id="UserData--name" name="UserData--name" type="text" /></div> [...]'
Die Länge der Ausgabe ist dadurch
bedingt, dass FormAlchemy Datumsfelder per Voreinstellung als
Auswahlmenüs darstellt, zumindest für Monat und Tag. Das Jahr ist ein
Textfeld mit einer Länge von vier. Das Feld ist aber trotzdem
optional, sofern es nicht in der Klasse als required()
gekennzeichnet wird.
Außerdem ist ein kurzer Schnipsel Javascript enthalten, welcher den
Fokus direkt auf das erste
Eingabefeld setzt. FormAlchemy verwendet
vergleichsweise lange Namen für die einzelnen Felder, welche sich aus
dem Formularnamen, zwei Minuszeichen und dem Feldnamen zusammensetzen,
also z. B. UserData--name.
Die öffnenden und schließenden <form>-Tags werden nicht automatisch
generiert, ebenso erzeugt FormAlchemy nicht die „Senden“-Schaltflächen.
Dies muss also später in der Applikation
händisch erfolgen.
Es ist auch möglich, nur einzelne Felder aus dem Formular rendern zu
lassen:
>>> ud = FieldSet(UserData)
>>> ud.configure(include=[ud.name])
>>> ud
<FieldSet (configured) with ['name']>
>>> ud.render()
u'<div><label class="field_req" for="UserData--name">Name</label>[...]
Die Liste hinter include enthält die Feldnamen, die dargestellt
werden sollen. Es ist auch möglich, ein Liste von Feldnamen
auszuschließen. Dafür wird include einfach durch exclude ersetzt.
Um ein Formular zu validieren, müssen zuerst Daten an das
Formular übergeben werden. Dies geschieht direkt beim Anlegen des
FieldSet:
>>> logindata = {'LoginForm--myemail': 'foo@bar.de',
'LoginForm--pass2': 'spamegg',
'LoginForm--pass1': 'spamegg'}
>>> lf = FieldSet(LoginForm, data=logindata)
>>> lf.data
SimpleMultiDict([('LoginForm--myemail', u'foo@bar.de'), ('LoginForm--pass2', u'spamegg'), ('LoginForm--pass1', u'spamegg')])
>>> lf.data['LoginForm--pass1']
u'spamegg'
>>> lf.validate()
True
Als Nächstes werden Daten übergeben, welche nicht validieren:
>>> baddata = {'LoginForm--myemail': 'foo_bar.de',
'LoginForm--pass2': 'spam',
'LoginForm--pass1': 'spamegg'}
>>> badform = FieldSet(LoginForm, data=baddata)
>>> badform.validate()
False
>>> badform.errors
{AttributeField(myemail): ['Missing @ sign'], AttributeField(pass2): ['Passw\xc3\xb6rter stimmen nicht \xc3\xbcberein.']}
>>> badform.render()
u'\n\n<div>\n <label class="field_req" for="LoginForm--myemail"> [...] <span class="field_error">Missing @ sign</span>\n</div>'
Auch diese Ausgabe ist gekürzt. Wie nicht anders zu erwarten, gibt der
Aufruf von validate() False zurück. Die Fehler sind in errors
hinterlegt. Wird das Formular gerendert, so werden die Fehler auch
direkt im Quelltext angezeigt.
Weitere Funktionen
Wie in der Einleitung bereits erwähnt, ist der Ursprung von FormAlchemy
das Generieren von Formularen aus gemappten Klassen aus SQLAlchemy.
Außerdem bietet das Framework auch Klassen und Funktionen, um
komplexere Formulare direkt in Form einer Tabelle darstellen zu lassen.
Des Weiteren gibt es unter anderem eine Anbindung von FormAlchemy an
CouchDB, Pylons sowie Zope, AJAX-basierte Formulare, die auf jQuery
zurückgreifen [15] sowie eine
Anbindung an Pyramid [16]. Wer sich näher mit
FormAlchemy beschäftigen möchte, der sollte einen Blick in die sehr
ausführliche und gut strukturierte Dokumentation [17] werfen.
Fungiform
Fungiform [18]
entstammt dem Pocoo-Umfeld [19] und war
ursprünglich Teil der in Python geschriebenen Blogsoftware „Zine“ [20],
wurde aber 2010 als eigenständiges Framework ausgelagert.
Fungiform trägt zwar „nur“ die Versionsnummer 0.1, ist in sich aber
ziemlich komplett, weiterhin gibt es scheinbar keine größeren Bugs
mehr. Jedenfalls traten bei den Tests mit Fungiform im Rahmen dieses
Artikels keine Probleme auf. Apropos Probleme: Es gibt zwei andere
„Probleme“ mit Fungiform. Das eine ist, dass es scheinbar keine
aktiven Entwickler gibt. Nach der Auslagerung von Fungiform im Sommer
2010 gab es zwar diverse kleinere Korrekturen, aber keine eigentliche
Weiterentwicklung. Der letzte Commit zum Quellcode stammt von Ende
2010. Das zweite, nicht ganz so große Problem ist, dass es keine
separate Dokumentation im HTML-Format oder ähnlichem gibt. Dies lässt
sich aber verschmerzen, da der Quellcode sehr gut und sehr ausführlich
dokumentiert ist. Wer sich mit Fungiform beschäftigen möchte, der
sollte Gebrauch von der in Python eingebauten help()-Funktion machen
oder die Doc-Strings direkt im Quelltext lesen. Die wichtigste Datei
ist dabei forms.py [21],
welche so gut wie alle Klassen und Funktionen enthält, die man später
auch für das eigene Programm benötigt.
Definition der Klassen
Wie bei den anderen bisher vorgestellten Frameworks wird auch hier die Struktur
für das HTML-Formular in einer Python-Klasse hinterlegt. Es gibt die
üblichen Feldtypen für Text, Zahlen, Auswahllisten usw. Weiterhin gibt
es einige „speziellere“ Formularelemente, wie z. B. zur Eingabe von
Komma-separierten oder Zeilenumbruch-separierten Daten. Außerdem kann
man auch in Fungiform Validatoren hinterlegen. Was sich bei Fungiform etwas
unterscheidet ist, dass einige „Basis-Validatoren“ bereits in den
Feldklassen hinterlegt sind. So kann man für einige Klassen wie z. B.
TextField die Attribute required, min_length oder max_length
direkt definieren, ohne dafür einen separaten Validator anlegen zu
müssen. Davon wird auch im folgenden Beispiel Gebrauch gemacht. Im
Gegenzug kennt Fungiform allerdings keine anderen vordefinierten Validatoren
– wie z. B. WTForms und Deform – welche unabhängig von einer
Klasse sind. Dafür kann man aber sehr einfach eigene Validatoren
schreiben.
# -*- coding: utf-8 -*-
from fungiform.forms import FormBase, TextField, DateField, \
ChoiceField, PasswordField, ValidationError
class UserData(FormBase):
def is_valid_name(self,value):
if value in ['admin','superuser']:
message = u'unerlaubter Benutzername'
raise ValidationError(message)
name = TextField(label=u'Name', required=True,
validators=[is_valid_name])
birthday = DateField(label=u'Geburtsdatum')
gender = ChoiceField(label=u'Geschlecht',
choices=[u'männlich',u'weiblich'])
class LoginForm(FormBase):
def is_valid_email(self,value):
if '@' not in value:
message = u'ungültige E-Mail Adresse'
raise ValidationError()
email = TextField(label=u'Email', required=True,
min_length=6, max_length=120)
pass1 = PasswordField(label='Passwort', required=True)
pass2 = PasswordField(label='Wiederholung', required=True)
def context_validate(self, data):
if data['pass1'] != data['pass2']:
message = u'Passwörter stimmen nicht überein'
raise ValidationError(message)
Listing: fungiform_form.py
Wie man sieht, kommen alle Importe aus fungiform.forms. Importiert
wird die Basisklasse für alle Formulare FormBase sowie die
benötigten Klassen für Formularfelder und der ValidationError,
welcher für die selbstgeschriebenen Validatoren benötigt wird.
Die beiden Klassen UserData und LoginForm besitzen jeweils einen
selbstdefinierten Validator. Diesem muss immer value übergeben
werden, was der zu prüfende Wert ist. Der anschließende Code kann
beliebiger Python-Code sein. Wenn die Validierung nicht erfolgreich
war, wird der ValidationError geworfen, wobei diesem eine
benutzdefinierte Fehlermeldung mitgegeben werden kann.
Der sonstige Code der Klassen sollte weitestgehend selbsterklärend
sein. Ist ein Feld ein Pflichfeld (wie z. B. name), so setzt man das
Attribute required=True. Übergibt man später Fungiform für die
Validierung des gesamten Formulars keinen Wert für dieses Feld, so wird
ein entsprechender Fehler geworfen.
In der Klasse LoginForm wird ein zusätzlicher Validator namens
context_validate benutzt, welcher die beiden Passworteingaben
vergleicht. Besitzt eine Klasse diesen, so wird er auf die gesamte
Klasse (das gesamte Formular) angewendet und nicht, wie die anderen
Validatoren, nur auf einzelne Instanzen einer Klasse. Im Gegensatz zu
einem „Einzelvalidator“ muss man context_validate immmer data
übergeben, welches alle Formulardaten enthält.
Formulare benutzen
Als Erstes soll wieder der HTML-Quelltext für das Formular generiert
werden. Dies geschieht bei Fungiform in zwei Schritten: Zuerst ruft man
die Funktion as_widget() auf, dann wird erst das eigentliche HTML
erzeugt. Als Parameter wird dem Formular dabei die gewünschte Ziel-URL als action mitgegeben:
>>> from fungiform_form import UserData, LoginForm
>>> ud = UserData(action='/foo')
>>> ud_widget = ud.as_widget()
>>> ud_widget()
u'<form action="/foo" method="post"><dl class="mapping"><dt><label for="f_name">Name</label></dt><dd><input type="text" id="f_name" value="" name="name"></dd> [...] <div class="actions"><input type="submit" value="Submit"></div></form>'
Um den Umfang des Artikels nicht zu sprengen, ist auch diese Ausgabe
gekürzt.
Ein direktes Rendern ist auch möglich:
>>> ud.as_widget().render()
u'<form action="/foo" method="post"> [...]'
Wie zu sehen ist, fügt Fungiform auch die <form>...</form> Tags
automatisch hinzu, ebenso wird die „Submit“-Schaltfläche automatisch
generiert. Wie auch bei den anderen Frameworks wird in den Tags eine
id angelegt. Hier werden Default-Werte seitens Fungiform verwendet,
diese können vor der Formulargenerierung aber auch überschreiben
werden.
Die voreingestellte Methode zum Senden des Formulars ist post, dies
kann aber recht einfach geändert werden:
>>> ud.default_method = 'get'
>>> ud_widget = myform.as_widget()
>>> ud_widget()
u'<form action="/foo" method="get">...'
Die Label für die einzelnen Felder sind wie folgt abrufbar:
>>> ud.name.label
u'Name'
Wie die anderen Frameworks kann Fungiform die für ein Formular
übermittelten Daten automatisch validieren. Dies kann ebenfalls in der
Pythonkonsole getestet werden:
>>> mydata = {'name':'Otto','gender':u'männlich','birthday':'1977-7-7'}
>>> ud.validate(mydata)
True
Da alle Werte gültig sind, validiert das Formular ohne Fehler. Wie
zu sehen ist, wurde auch hier das Datum als String übergeben. Fungiform
wandelt diesen automatisch bei der Validierung in ein Datetime-Objekt
um. Dies ist zu sehen, wenn der übermittelte Wert aufgerufen wird:
>>> ud['birthday']
datetime.date(1977, 7, 7)
Alle Daten können wie folgt abgerufen werden:
>>> ud.data
{'gender':u'm\xe4nnlich','birthday':datetime.date(1977,7,7),'name':u'Otto'}
Als Nächstes werden an das Formular Daten übermittelt, welche nicht
gültig sind:
>>> mydata = {'name':'admin','gender':u'mann','birthday':''}
>>> ud.validate(mydata)
False
>>> ud.errors
{'name': [u'unerlaubter Benutzername'],
'gender': [u'Please enter a valid choice.']}
Wie erwartet validiert das Formular nicht. Die Fehlermeldungen werden in
errors gespeichert. Ruf man diese auf, sind die Fehlermeldungen
als Dictionary zu sehen. Sofern keine eigene Fehlermeldung vorgegeben
wurde – wie im Falle des Felds gender – wird die Standardfehlermeldung für diesen Feldtyp verwendet.
Der Status der letzten Validierung kann auch aufgerufen werden, ohne das
ganze Formular erneut zu validieren:
>>> ud.is_valid
False
Weitere Funktionen
Fungiform bietet natürlich noch weitere Möglichkeiten als die hier
gezeigten. So ist es z. B. auch möglich, eigene Feldtypen zu
definieren, Feldern „Widgets“ mitzugeben, um deren Verhalten zu ändern
usw. Dies ist auch in der eingebauten Dokumentation (kurz)
erklärt.
Eingangs wurde bereits erwähnt, dass auch Fungiform alle gängigen
Feldtypen generieren kann sowie ein paar „Extrafelder“ an Bord hat.
Des Weiteren unterstützt Fungiform den Einsatz
von Recaptchas [22]
und bietet mit Bordmitteln
Schutz vor Cross-Site-Request-Forgery [23].
Aufgrund der fehlenden Dokumentation müssen auch hier der Quelltext beziehungsweise die
Kommentare darin gelesen werden, um herauszufinden, wie diese
Funktionen zu nutzen sind.
Flatland
Flatland trägt ebenso wie Fungiform eine recht niedrige
Versionsnummer, nämlich 0.0.1, und wird auf PyPi [24] mit dem Status „beta“ deklariert. Laut
Homepage des Projekts [25] ist
das Framework komplett, frei von größeren Bugs, einsatzfähig und auch
tatsächlich im Einsatz. Bei den Tests mit Flatland für diesen Artikel
traten in der Tat keine Probleme auf – aber es fehlt noch
Dokumentation [26]. Dies ist
aktuell in der Tat das größte Manko von Flatland. Es gibt zwar eine
schon recht umfangreiche Dokumentation [27],
diese beschreibt aber fast ausschließlich das Anlegen von eigenen Klassen und den
Einsatz der
verschiedenen existierenden Felder. Eine Erklärung, wie man
aus einer Formularklasse HTML erzeugt, fehlt z. B. noch vollständig.
Glücklicherweise wurde auf der Europython 2010 ein Vortrag zu Flatland
gehalten, welcher die Nutzung komplett, wenn auch relativ kurz,
erläutert [28]. Wer sich näher mit Flatland
beschäftigen möchte, der sollte sich die Folien unbedingt ansehen.
Ähnlich wie das im Rahmen von Deform angesprochene Colander, kann
Flatland auch komplexere Datenstrukturen darstellen, da sich mehrere
Felder beliebig in Dictionaries und Listen zusammenfassen lassen.
Diese dürfen auch wiederum Dictonaries und Listen enthalten. Darauf
wird im Rahmen dieses Artikels aber nicht eingegangen.
Anlegen der Formulare
Die Klassen für die Formulare sehen mit Flatland so aus:
# -*- coding: utf-8 -*-
from flatland import Form, String, Date
from flatland.validation import Present, ValueIn, IsEmail, \
ValuesEqual, IsEmail
GENDER_DATA = [u'männlich',u'weiblich']
def not_allowed_name(element, state):
if element.value in ['admin','superuser']:
element.errors.append(u'Verbotener Name')
return False
class UserData(Form):
name = String.using(label = u'Name',
validators=[Present(missing=u'Kein Name eingegeben'),
not_allowed_name])
birthday = Date.using(label = u'Geburtsdatum',optional = True)
gender = String.using(label = u'Geschlecht',
validators=[Present(missing=u'Geschlechtsangabe fehlt'),
ValueIn(GENDER_DATA,fail =
u'"
class LoginForm(Form):
email = String.using(label='E-Mail',
validators=[
Present(missing=u'Kein E-Mail Adresse eingegeben'),
IsEmail(invalid=u'Keine gültige E-Mail Adresse')])
pass1 = String.using(label = u'Passwort',
validators=[Present(missing = 'Kein Passwort eingegeben')])
pass2 = String.using(label = u'Passwort Wiederholung',
validators=[Present(missing = 'Passwortwiederholung fehlt')])
validators = [
ValuesEqual(pass1,pass2)]
Listing: flatland_forms.py
Als Erstes werden wieder die notwendigen Importe durchgeführt, einmal
für die verwendeten Felder und einmal für die eingesetzten
Validatoren. Ansonsten wird für jedes Feld zuerst der Datentyp
festgelegt und danach das Label sowie die anzuwendenden Validatoren.
Weiterhin wird in der Klasse UserData ein eigener Validator namens
not_allowed_name definiert. Dieser wird später im Feld name
eingesetzt und prüft, ob der eingegebene Name innerhalb der nicht
erlaubten Liste von Namen liegt.
Bei der Klasse LoginForm wird ein Validator außerhalb der
Felddefinition eingesetzt. Dieser wird also auf das gesamte Formular
angewendet. Dies ist immer dann praktisch, wenn – so wie hier –
Eingaben aus verschiedenen Feldern miteinander verglichen werden
sollen. Etwas umständlich ist die Tatsache, dass Flatland zwar selbst
definierbare Fehlermeldungen bei nicht erfolgreicher Validierung
erlaubt, die Definition an sich aber nicht einheitlich ist. Wie auch
im Listing 5 oben zu sehen ist, wird die eigene Fehlermeldung im Falle des
Validators Present über missing = '...' festgelegt, im Falle des
Validators IsEmail aber über invalid = '...'. Einheitlicher
ist eher der Weg, den die anderen Frameworks
wählen,.
Im Gegensatz zu allen anderen hier vorgestellten Formular-Frameworks
kennt Flatland scheinbar keinen eigenen Feldtyp für ein Auswahlfeld.
„Scheinbar“ deshalb, weil im Rahmen der Recherche dieses Artikels
dieser Feldtyp zwar nicht aufzufinden war, es aber nicht
auszuschließen ist, dass das Auswahlfeld schlichtweg noch nicht
dokumentiert ist und somit nicht „gefunden“ wurde.
Tests mit Flatland in der Python-Shell
Im Folgenden werden die mit Flatland definierten Klassen für die
Formulare ein wenig in der Python-Shell erkundet. Zuerst werden die
beiden Formularklassen importiert,
>>> from flatland_forms import LoginForm, UserData
und eine eigene Klasse daraus instanziiert:
>>> ud = UserData()
Der Aufruf von ud gibt die Feldnamen und die aktuellen Werte zurück:
>>> ud
{u'birthday': <Date u'birthday';value=None>, u'name': <String u'name'; value=None>, u'sex': <String u'sex'; value=None>}
Da noch keine Werte übergeben wurden, ist value natürlich überall
None. Einzelne Felder sind wie bei Dictionaries aufrufbar:
>>> ud['name']
<String u'name'; value=None>
Die Label für Felder können wie folgt aufgerufen werden:
>>> ud['name'].label
u'Name'
Als Nächstes werden Daten an das Formular übergeben und validiert:
>>> from datetime import date
>>> mydata = {'name':'Otto',
'gender':u'männlich',
'birthday':date(1977,1,1)}
>>> ud.set(mydata)
True
>>> ud.validate()
True
>>> ud
{u'gender': <String u'gender'; value=u'm\xe4nnlich'>, u'birthday': <Date u'birthday'; value=datetime.date(1977, 1, 1)>, u'name': <String u'name'; value=u'Otto'>}
Flatland erwartet, wie zu sehen ist, für das Geburtsdatum explizit ein
Python-Date-Objekt. Ein String in der Form 1977-1-1, wie ihn die
anderen Frameworks als gültiges Datum akzeptieren, führt in Flatland
zu einem Fehler.
Als Nächstes wird das Formular gegen einen ungültigen Datensatz
validiert:
>>> mydata = {'name':'admin',
'gender':u'männlich',
'birthday':date(1977,1,1)}
>>> ud.set(mydata)
True
>>> ud.validate()
False
Wie nicht anders zu erwarten, schlägt die Validierung fehl. Leider
speichert Flatland keine Fehlerliste, welche für das ganze Formular
gilt. Vielmehr werden die Fehler in den jeweiligen zugehörigen Feldern
hinterlegt. Von daher muss man über diese iterieren, um die Fehler zu
sehen:
>>> for k in ud.iterkeys():
... print k, ud[k].valid
... print k, ud[k].errors
...
gender True
gender []
birthday True
birthday []
name False
name [u'Verbotener Name']
Flatland ist das einzige der hier vorgestellten Frameworks, das für
das Rendern der Formulare nach HTML einen eigenen Import benötigt,
nämlich den Generator:
>>> from flatland.out.markup import Generator
Dies ist übrigens zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Artikels
vollständig undokumentiert, d. h. in der offiziellen Dokumentation
an keiner Stelle erwähnt.
Danach können die Formularfelder generiert werden:
>>> gen = Generator()
>>> gen.input(ud['name'], type='text')
<input type="text" name="name" value="" />
Ähnlich wie WTForms rendert Flatland die Felder einzeln. Das
komplette Rendern eines ganzen Formulars wird nicht unterstützt. Wie
zu sehen ist, wird über gen.input() ein <input>-Feld generiert,
type='text' legt den Typ als Textfeld fest.
Da Flatland scheinbar keine Auswahlfelder unterstützt,
müssen diese von Hand „gebaut“ werden:
>>> from flatland_forms import GENDER_DATA
>>> gen.select.open()
u'<select>'
>>> for i in GENDER_DATA:
... gen.option.open(),\
... i,gen.option.close()
...
u'<option> männlich </option>'
u'<option> weiblich </option>'
>>> gen.select.close()
u'</select>'
Der Generator aus Flatland ist also recht flexibel und kann alle für
Formulare benötigten HTML-Tags generieren. Nichtsdestotrotz ist
diese Vorgehensweise vergleichsweise aufwändig.
Sonstiges
Neben diversen weiteren Feldtypen sowie der Möglichkeit der
Verschachtelung von Feldern kennt Flatland auch noch „Signals“ [29].
Diese können in den Programmcode eingebaut werden und senden während
der Verarbeitung von Formularen zu oder nach einem bestimmten Ergebnis,
wie einer erfolgreichen Validierung, ein Signal an eine Liste
vordefinierter Empfänger. Des Weiteren gibt es eine Anbindung an die
beiden Template-Engines „Genshi“ und „Jinja2“ [30].
Weitere Alternativen
Die hier vorgestellten Programme stellen natürlich nur einen
Ausschnitt der existierenden Frameworks dar. Ein weiteres ist z. B.
FormEncode [31]. Noch mehr
Alternativen sind auf PyPi zu finden, wenn z. B. als Suchbegriff „html
form“ eingegeben wird.
Wird das für Webapplikationen auch sehr populäre Django [32]
genutzt, so steht hier ein eigenes Modul für HTML-Formulare bereit [33],
welches natürlich komplett in Django integriert ist.
HTML-Framework in Webapplikationen
Im Rahmen dieses Artikels wurden die verschiedenen Frameworks
ausschließlich in der Python-Shell erkundet. Die Nutzung innerhalb
einer realen Webapplikation ist aber auch nicht weiter schwierig,
zumal das prinzipielle Vorgehen grundsätzlich für alle vorgestellte Frameworks gleich ist.
Es gibt grundsätzlich drei verschiedene Zustände, die im
Programmablauf berücksichtigt werden müssen:
- es wurde noch kein Formular generiert
- es wurde ein ausgefülltes Formular von der Webseite gesendet, dieses validiert aber nicht, d. h. es enthält Fehler
- es wurde ein ausgefülltes Formular von der Webseite gesendet und dieses validiert
Weiterhin gilt es zu bedenken, dass alle Frameworks, wie weiter oben
bereits erwähnt, Unicode-Daten erwarten, die Webseite aber codierte
Daten liefert.
Im Folgenden wird eine minimale Webapplikation mit nur einem Formular
mit Hilfe von WTForms und Bottle (siehe Artikel in freiesMagazin 2/2011 [34]) gezeigt. Der Code ist nicht weiter spezifisch für Bottle und
sollte sich sehr einfach auch auf andere Webframeworks übertragen
lassen. Der Austausch von WTForms gegen ein anderes Formular-Framework
sollte sich auch einfach bewerkstelligen lassen. Der Code besteht
dabei aus zwei Teilen: Der Applikation an sich und dem zugehörigen
Template.
my_form_app.py
template.tpl
In my_form_app.py wird zuerst die notwendige Dekodierung von UTF-8 nach
Unicode für alle eingegebenen Werte durchgeführt. Dabei ist zu
beachten, dass es sich um eine „minimale“ Konvertierung im Rahmen
dieses Beispiels handelt. Das im Template generierte HTML stellt nicht
sicher, dass die Eingabe wirklich immer UTF-8 ist und fängt auch nicht
das mögliche Fehlverhalten älterer Browser (wie z. B. Microsofts Internet
Explorer 6)
ab.
Da die Namen aller Formularfelder ausschließlich aus ASCII-Zeichen
bestehen, ist eine Dekodierung der Feldnamen nicht notwendig. Danach
wird die oben beschriebene Prüfung auf den Zustand durchgeführt, wobei
dieser für „noch kein Formular generiert“ und „validiert nicht“
praktischerweise zusammengefasst ist.
Das zugehörige Template in template.tpl gibt standardmäßig nur das
Formular aus. Die Fehler werden nur angezeigt, wenn errors vorhanden
ist, was nach einer nicht erfolgten Validierung der Fall ist.
Deform kommt übrigens nicht mit dem verwendeten MultiDict von Bottle
zurecht, es wird dann ein ValueError geworfen. Soll das Beispiel auf
Deform übertragen werden, so sollte req_unicode als Liste angelegt
und dann Feldname und Wert als Tuple darin hinterlegt werden.
Zusammenfassung
Trotz einiger Gemeinsamkeiten und dem gleichen Ziel zeigen sich doch
eine Reihe von Unterschieden in den fünf in diesem Artikel vorgestellten Frameworks.
Deform setzt auf ein separates Modul beim Anlegen der Klassen für die
Struktur und Felder der Formulare. Beim Rendern wird direkt Javascript
mit eingebunden, auch wenn die Nutzung letztendlich nur optional ist.
WTForms, FormAlchemy und Fungiform sind recht ähnlich, was die
Definition der Formulare angeht. WTForms erlaubt eine unkomplizierte
Definition der Formularfelder und bringt bereits eine Vielzahl von
Validatoren mit. Felder werden einzeln gerendert, was die Integration
in eine Applikation recht einfach macht – auch im Nachhinein.
Auch wenn FormAlchemy ursprünglich zur Nutzung in Kombination mit
SQLAlchemy gedacht war, spricht nichts dagegen, auch dieses Framework
„stand alone“ zu nutzen. Klassen mit Formularfeldern sind schnell
angelegt, ebenso einfach ist die Einbindung von Validatoren. Formulare
können wahlweise komplett oder feldweise generiert werden.
Fungiform ist trotz der niedrigen Versionsnummer recht komplett und
bietet eine sehr durchdachte, praxisnahe Mischung aus eingebauten und
externen Validatoren. Weiterhin kennt das Framework einige spezielle
Felder wie zum Beispiel für Komma-separierte Daten. Einziger Wermutstropfen
ist der aktuell fehlende Maintainer und die dadurch bedingte
vielleicht ungewisse Zukunft.
Flatland kann seine Stärken besonders bei komplexen und verschachtelten
Formularen zeigen, da es hier deutlich mehr Möglichkeiten bietet, zumindest im Vergleich zu Fungiform, WTForms und FormAlchemy.
Das Generieren von
HTML schwankt zwischen einfach und eher umständlich. Ein echtes Manko
ist die unvollständige Dokumentation.
Fazit
Welches Framework eingesetzt wird ist letztendlich
Geschmackssache. WTForms, FormAlchemy und Fungiform sind in etwa auf
Augenhöhe und gleichermaßen für den täglichen Einsatz geeignet. Deform
ist etwas aufwändiger zu nutzen, da für das Anlegen der Formularklassen
ein externes Modul genutzt wird. Bei komplexen,
verschachtelten Formularen haben Deform und Flatland Vorteile, weil
sie entsprechende Datenstrukturen direkt abbilden können. Beim Einsatz
von Flatland ist aber aufgrund der lückenhaften Dokumentation etwas
Pioniergeist seitens des Anwenders gefordert.
Links
[1] https://docs.pylonsproject.org/projects/deform/dev/
[2] https://docs.pylonsproject.org/projects/colander/dev/
[3] https://docs.pylonsproject.org/projects/peppercorn/dev/
[4] http://chameleon.repoze.org/
[5] https://docs.pylonsproject.org/projects/deform/dev/basics.html#validating-a-form-submission
[6] https://docs.pylonsproject.org/projects/deform/dev/common_needs.html#using-the-autocompleteinputwidget
[7] http://wtforms.simplecodes.com/
[8] http://wtforms.simplecodes.com/docs/0.6.2/
[9] http://wtforms.simplecodes.com/docs/0.6.2/ext.html
[10] http://code.google.com/p/formalchemy/
[11] http://www.sqlalchemy.org
[12] http://pypi.python.org/pypi/WebOb/1.1.1
[13] http://pypi.python.org/pypi/WebHelpers/1.3
[14] http://pypi.python.org/pypi/Tempita/0.5.1
[15] http://docs.formalchemy.org/fa.jquery/
[16] http://docs.formalchemy.org/pyramid_formalchemy/
[17] http://docs.formalchemy.org/
[18] http://www.pocoo.org/projects/fungiform/#fungiform
[19] http://www.pocoo.org/
[20] http://www.pocoo.org/projects/zine/#zine
[21] https://github.com/mitsuhiko/fungiform/blob/master/fungiform/forms.py
[22] http://de.wikipedia.org/wiki/ReCAPTCHA
[23] http://de.wikipedia.org/wiki/Cross-Site_Request_Forgery
[24] http://pypi.python.org/pypi
[25] http://discorporate.us/projects/flatland/
[26] https://bitbucket.org/jek/flatland/wiki/Todo
[27] http://discorporate.us/projects/flatland/docs/tip/
[28] http://rswilson.ch/flatland/
[29] http://discorporate.us/projects/flatland/docs/tip/signals.html
[30] http://discorporate.us/projects/flatland/docs/tip/templating/index.html
[31] http://www.formencode.org/en/latest/index.html
[32] https://www.djangoproject.com/
[33] https://docs.djangoproject.com/en/1.3/topics/forms/
[34] http://www.freiesmagazin.de/freiesMagazin-2011-02
| Autoreninformation |
| Jochen Schnelle (Webseite)
schreibt selber Web-basierte Python-Applikation und
nutzt WTForms. Beim Blick über den Tellerrand entstand dieser Artikel
zu den verschiedenen HTML-Formular-Frameworks.
|
| |
Diesen Artikel kommentieren
Zum Index
von Tobias Hansen
Adventure-Fans wird der Name SCUMM [1]
sicherlich etwas sagen. SLUDGE [2]
ist eine freie Alternative dazu und bringt selbst noch
Entwicklerwerkzeuge mit. Mit diesem System kann man auf jeder
Plattform Grafikadventures entwickeln und spielen. Der vorliegende
Artikel soll einen kleinen Einblick in die ersten Schritte der
Spielentwicklung mit SLUDGE geben.
Da die Geschichte von SLUDGE als Windows-Programm bereits mehr als
zehn Jahre zurückreicht, sind schon einige relativ aufwändige Spiele
entstanden. Weil SLUDGE mittlerweile auch auf anderen Plattformen
erschienen ist, laufen diese Spiele nun natürlich auch unter Linux.
Auf der SLUDGE-Homepage ist eine Liste der verfügbaren
Spiele [3] zu finden. Der
Wikiartikel zu SLUDGE auf ubuntuusers.de [4]
enthält ähnliche Informationen auf deutsch.
Adventures entwickeln mit SLUDGE
Der aufwändigste Teil bei der Entwicklung eines Adventures ist
sicherlich der kreative – Story, Rätsel und Dialoge ausdenken,
Hintergründe und animierte Objekte zeichnen, Musik, Sprache und
Sounds aufnehmen. Dagegen ist das Zusammensetzen der Einzelteile ein
Kinderspiel.
Um die mühsam erstellten Ressourcen in ein Spiel einzubinden und
mögliche Interaktionen mit der Spielwelt einzuprogrammieren, wird
bei SLUDGE eine Skriptsprache verwendet, die
selbst auch SLUDGE
(Scripting Language for Unhindered Development of a Gaming
Environment) heißt. Außerdem besteht so die Möglichkeit, das
Spielinterface völlig frei selbst zu gestalten.
Möchte man sich anfangs nicht mit dem Implementieren der
Benutzerschnittstelle herumschlagen, sondern sofort den eigenen
Charakter herumlaufen sehen, sollte man sich zu Beginn an dem Code
eines funktionierenden Spiels orientieren. Hier bietet sich zum
einen das im SLUDGE-Sourcecode-Archiv [5]
(im Ordner doc/ExampleProjects) enthaltene „Verb Coin Example“ an.
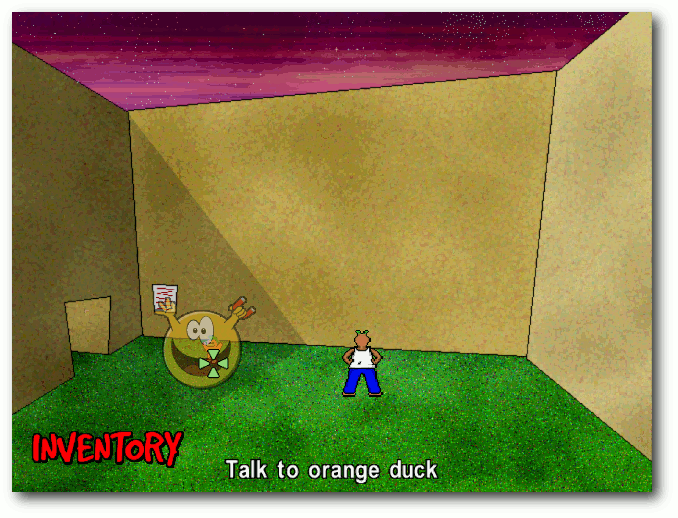
Verbmünzen-Interface beim „Verb Coin Example“.
Ein Beispielprojekt, das statt Verbmünzen-Interface ein klassisches
SCUMM-Interface bietet, ist „The Interview“ (siehe
Sourcecode-Bereich auf der SLUDGE-Homepage [6]).
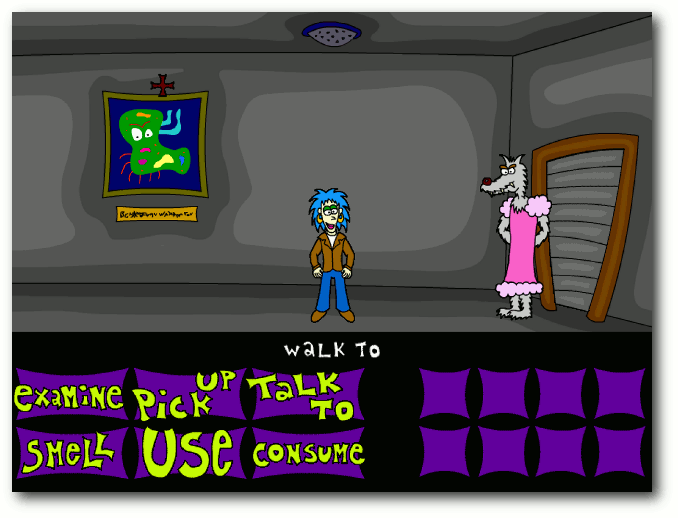
SCUMM-Interface bei „The Interview“.
Neben der Skriptsprache bietet SLUDGE fünf grafische Programme für
recht spezialisierte Aufgaben. Drei davon dienen der
Projektverwaltung, dem Erstellen von Übersetzungen und dem Umwandeln
von Animationen in das von SLUDGE benötigte Format. Auf die anderen
beiden
(Floor Maker und Z-Buffer Maker) wird weiter unten noch
genauer eingegangen.
Ein ständiger Begleiter beim Entwickeln mit SLUDGE ist die
Dokumentation [7].
Dort werden fast alle Fragen beantwortet.
Erste Schritte
Nun soll zur Demonstration der bei SLUDGE gängigen Konzepte
beschrieben werden, wie mit dem Umwandeln des Verb Coin Example in
ein eigenes Adventure begonnen werden kann.
Während der Einstiegspunkt für den Code in der Datei init.slu zu
finden ist, beginnt der zum Spielinhalt gehörende Code in
outside/room.slu. Wer sich etwas im Verb Coin
Example umgeschaut hat, wird hier alles wiederfinden, was im ersten
Raum passiert. Die Funktion outsideRoom() wird jedes Mal aufgerufen,
wenn der Raum betreten wird. Da nun
ein neues Spiel gestaltet werden
soll, wird fast alles aus der Datei
gelöscht, sodass nur
Folgendes übrig bleibt:
sub outsideRoom () {
startMusic ('outside/music.xm', 0, 0);
addOverlay ('outside/room.tga', 0, 0);
setFloor ('outside/room.flo');
setScale (200, 150);
setZBuffer ('outside/room.zbu');
addCharacter (ego, 420, 400, makeEgoAnim ());
%~ say (ego, "Moin, moin! Scheint ja noch zu kompilieren der Code!");
}
Listing: room.slu
Die ersten fünf Zeilen laden Musik und Raum, dann wird der
Spielcharakter angezeigt und zum Reden gebracht.
Damit das Projekt wieder kompiliert wird, müssen folgende Zeilen aus
der Datei iface/inventory.slu gelöscht werden, da hier das Objekt
duck referenziert wird, das soeben gelöscht wurde.
event duck {
say (ego, "Hey, duck! Want a mushroom?");
say (duck, "Er, no...");
say (ego, "Ah well. I'll wander around with it for a little longer, then.");
}
Nun kann das Projekt (VerbCoin.slp) mit dem Projekt-Manager
geöffnet und inside/room.slu und german.tra aus dem Projekt
entfernt werden. Jetzt sollte das Kompilieren wieder klappen.
Startet man das neu kompilierte Spiel, gibt es
keine Ente mehr in
dem Raum. Auch kann man nicht mehr mit der Notiz oder dem Tunnel
interagieren. Nun kann es an das Erstellen eines neuen Hintergrundes
gehen.
Der erste eigene Raum
Jetzt beginnt die wirkliche Arbeit: Ein neuer Raum muss gestaltet
werden. Das bevorzugte Dateiformat für Graphiken ist PNG, auch wenn
das Verb Coin Example aus einer Zeit stammt, in der SLUDGE nur TGA
verstand. Der Hintergrund wird in Zeile 3 in outside/room.slu ins
Spiel eingebunden. Da sich die Endung im Dateinamen ändert, muss der
Aufruf angepasst werden.
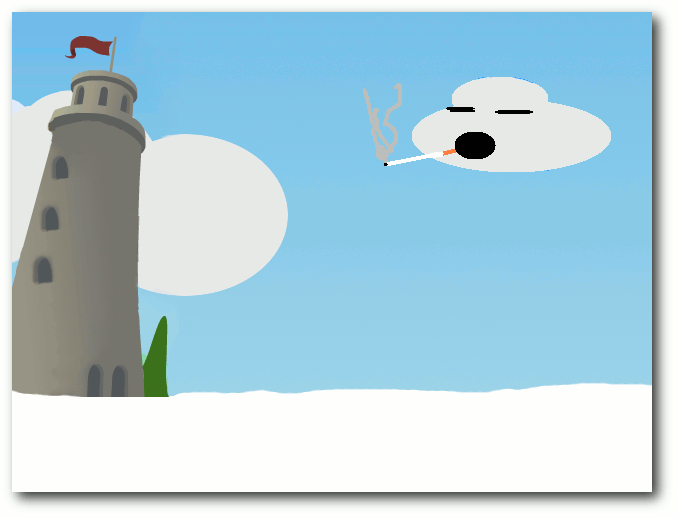
Beispiel für ein eigenes Hintergrundbild.
Dann muss festgelegt werden, wo der Protagonist herumlaufen darf.
Dazu kann man einfach den vorhandenen Fußbodenplan room.flo im Floor
Maker öffnen, das neue Hintergrundbild laden und die Ecken des
Bodenbereichs zu den gewünschten Positionen ziehen.
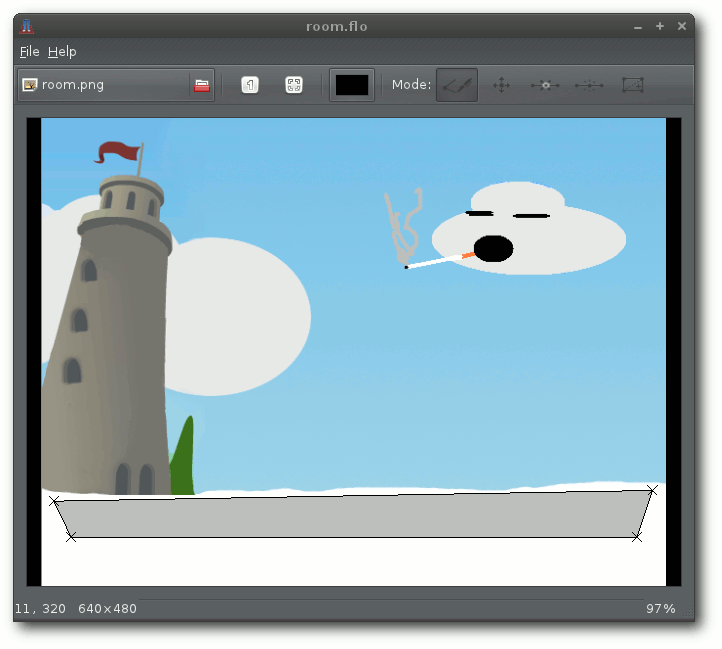
Floor Maker bei der Arbeit.
Jetzt kann man im Spiel auf dem neuen Hintergrund herumlaufen.
Allerdings ist der Protagonist viel größer als die Tür des Turmes,
selbst wenn er direkt davor steht. Um einzustellen, wie groß Objekte
an welcher Bildschirmposition sind, gibt es die Funktion
setScale(), (Zeile 5 in
outside/room.slu). Die richtigen Werte
herauszubekommen ist etwas knifflig, Hilfe gibt die
SLUDGE-Dokumentation [8].
In diesem Beispiel wird folgendes verwendet:
setScale (370, 30);
Interaktion!
Diese Wolke sieht interessant aus. Und in
Adventures möchte man sich interessante Dinge meist etwas genauer
anschauen. outside/room.slu wird also wie
folgt erweitert:
sub outsideRoom () {
startMusic ('outside/music.xm', 0, 0);
addOverlay ('outside/room.png', 0, 0);
setFloor ('outside/room.flo');
setScale (370, 30);
setZBuffer ('outside/room.zbu');
addScreenRegion (cloud, 357, 65, 599, 161, 503, 380, NORTH);
addCharacter (ego, 420, 400, makeEgoAnim ());
say (ego, "Moin, moin! Scheint ja noch zu kompilieren, der Code!");
}
objectType cloud ("Merkwuerdig aussehende Wolke") {
event lookAt {
say (ego, "Komisch, die Wolke sieht so aus, als ob sie eine Zigarette raucht.");
}
event talkTo {
say (ego, "Haaallooo Wooolkeee!");
pause(20);
turnCharacter (ego, SOUTH);
say (ego, "Na ja, so wie sie aussieht, scheint sie zu schlafen.");
}
}
Listing: room2.slu
In Zeile 8 wurde ein Bildschirmbereich für das Objekt cloud
hinzugefügt. Die ersten vier Zahlen markieren die Koordinaten von
zwei Ecken eines Rechtecks, das den Bereich definiert. Die anderen
Zahlen geben an, wo der Protagonist hinlaufen soll, wenn mit der
Wolke interagiert werden soll, und die letzte Angabe bestimmt, in
welche Richtung er während der Interaktion guckt.
Die Koordinaten können ermittelt werden, indem das Hintergrundbild im
Floor Maker geladen wird. Am unteren Rand des Floor Makers werden
die Koordinaten des Mauszeigers angegeben.
Außerdem wurde das Objekt cloud erzeugt, mit je einer Aktion fürs
Ansehen und Ansprechen.
Nichts wie raus hier
Zum Schluss soll noch ein Ausgang eingebaut werden. Der Protagonist
soll auf Kommando in den Turm hineinlaufen, dann soll das Spiel
beendet werden. Das funktioniert, ähnlich wie bei
der Wolke, mit einer
Kombination von ScreenRegion und Objekt. Dazu fügt man unter die
bereits vorhandene addScreenRegion-Zeile in sub outsideRoom()
die Zeile
addScreenRegion (intoTower, 75, 351, 115, 384, 127, 388, WEST);
ein. Ganz am Ende der Datei muss man dann noch das neue Objekt
intoTower einfügen:
objectType intoTower ("Turmeingang") {
event oneCursor = arrowEast;
event onlyAction {
forceCharacter (ego, 108, 382);
forceCharacter (ego, 60, 382);
pause(40);
quitGame ();
}
}
Die forceCharacter-Befehle bewirken, dass der Charakter aus seinem
angestammten Fußbodenbereich heraus in die rechte Tür und dann etwas
nach links läuft. Doch halt, nun scheint er vor dem Turm
herumzufliegen. Hier wird ein Z-Buffer benötigt, damit der Charakter
nur durch die Türöffnungen zu sehen ist, ansonsten aber hinter dem
Turm verschwindet.

Hinter dem roten Bereich soll der Protagonist verschwinden …
Es muss ein TGA-Bild mit schwarzem Hintergrund erstellt werden, in
dem verschiedene Bereiche, hinter denen der Charakter verschwinden
soll, einfarbig ausgemalt werden. Dieses Bild wird mit dem Z-Buffer
Maker geöffnet und jeder Ebene wird eine y-Koordinate zugeordnet.
Steht der Charakter mit den Füßen unterhalb dieser Koordinate, wird
er vor der betreffenden Ebene gezeichnet. Sobald er die Linie
überschreitet, wird er von dem
entsprechenden Teil des
Hintergrundbildes verdeckt.
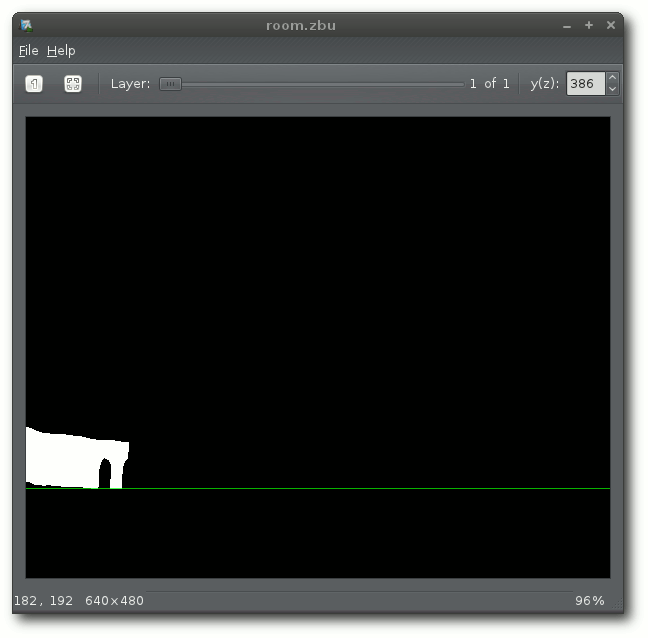
… wenn er sich oberhalb der grünen Linie befindet.
Fazit
Nun sollte es dem geneigten Leser möglich sein, anhand der Dokumentation von SLUDGE und dem
Beispielcode auch die Spielfigur zu ersetzen und
vielleicht sogar ein eigenes kleines oder auch größeres
Adventure
zu verwirklichen.
Das hier im Artikel vorgestellte Beispiel kann
zusammen mit allen wichtigen Projektdateien und Bildern
als Archiv heruntergeladen werden.
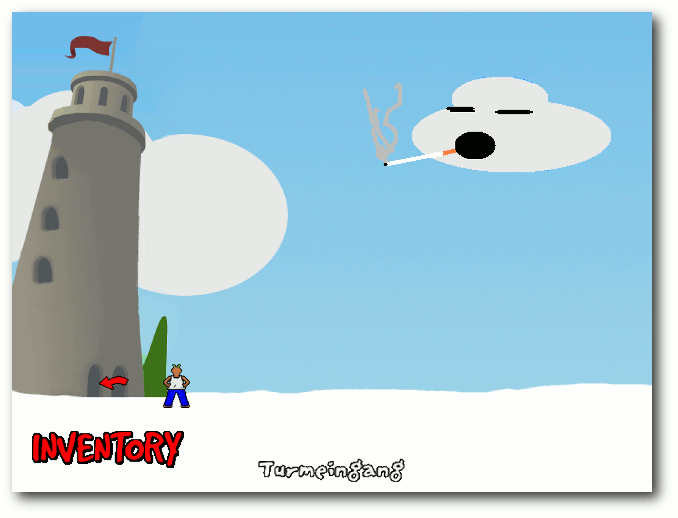
Der Protagonist denkt ans Aufhören.
Links
[1] http://de.wikipedia.org/wiki/Script_Creation_Utility_for_Maniac_Mansion
[2] http://opensludge.sourceforge.net
[3] http://opensludge.sourceforge.net/games.html
[4] http://wiki.ubuntuusers.de/OpenSLUDGE
[5] http://opensludge.sourceforge.net/download.html
[6] http://opensludge.sourceforge.net/resources.html#sourcecode
[7] http://opensludge.svn.sourceforge.net/viewvc/opensludge/doc/SLUDGE_Help.html
[8] http://opensludge.svn.sourceforge.net/viewvc/opensludge/doc/SLUDGEDevKitHelp/Scaling_Characters.html
| Autoreninformation |
| Tobias Hansen
spielte 2004 „Out Of Order“ und nennt das SLUDGE-Spiel
seitdem als eines seiner Lieblings-Fanadventures. Anfang 2010 stieß
er zufällig wieder auf das inzwischen quelloffene SLUDGE und
beschloss, es nach Linux zu portieren.
|
| |
Diesen Artikel kommentieren
Zum Index
von Patrick Eigensatz
Im vorangegangenen Artikel (siehe freiesMagazin
11/2011 [1])
ging es um Variablen, Kontrollstrukturen und Funktionen in PHP. Nun
wird etwas mehr auf Datenfelder eingegangen. Weiterhin wird noch
gezeigt, wie man sich ein sicheres Log-in programmiert, in welchem man
eingeloggt bleibt. Am Ende des Artikels wird außerdem auf
Sicherheitsprobleme mit PHP hingewiesen.
Auflösung der Escape-Aufgabe
Die Escapeaufgabe aus dem letzten Artikel war:
<?php
$var1 = '\'\'\'';
$var2 = "\"\"" . '"';
echo "$var1$var2$var1\"";
?>
Wenn man die maskierten Zeichen auflöst und die Strings nicht mit
Anführungszeichen umgibt, ergeben sich folgende Werte für $var1
und $var2:
$var1 = ''' // drei einfache Anführungszeichen
$var2 = """ // drei doppelte Anführungszeichen
Zusammen ergibt das (ohne Leerzeichen):
' ' ' " " " ' ' '
Hinzu kommt das maskierte doppelte Anführungszeichen, das beim
echo-Befehl angefügt wurde. Die Lösung ist also:
' ' ' " " " ' ' ' "
Arrays
Arrays wurden bereits in einem der vorherigen Teile vorgestellt,
sollen in diesem Teil aber etwas näher behandelt werden. Bei Arrays
handelt es sich um Variablen, die mehrere Werte speichern können.
In den vorhergehenden Teilen wurden Arrays als „Hängemappenregister“
vorgestellt. Es wird unterschieden zwischen Listen-Arrays und
assoziativen Arrays.
Listen-Arrays
Man stelle sich vor, man will 20 Zufallszahlen zwischen 1 und 100
generieren. Die Funktion, um eine Zufallszahl zu generieren, heißt
rand. Man wendet sie zum Beispiel so an:
$zahl1 = rand(1, 100);
$zahl2 = rand(1, 100);
...
$zahl19 = rand(1, 100);
$zahl20 = rand(1, 100);
Die Nachteile dieses Codes sind die Unübersichtlichkeit und der
Platzverbrauch. Besser geht es mittels einer for-Schleife
und einem Array:
$zufallszahl = array();
for($nummer = 1; $nummer <= 20; $nummer++) {
$zahl = rand(1, 100);
array_push($zufallszahl, $zahl);
}
Dieser Code bewirkt fast dasselbe. Anstelle der Definition von 20
Variablen wird eine „Sammelvariable“ definiert. Dies geschieht mit
$zufallszahl = array();
Dann wird die Schleife solange ausgeführt, wie $nummer kleiner oder
gleich 20 ist. $nummer wird bei jedem Durchgang um eins erhöht.
Während jedes Durchgangs ist $zahl eine neue Zufallszahl. Diese wird
mithilfe von array_push in ein Array eingefügt. Ist die Schleife
fertig, kann man, ähnlich wie bei $_POST oder $_GET, über die
eckigen Klammern auf die Werte zugreifen. Der einzige Unterschied
besteht darin, dass hier Zahlen zwischen den Klammern stehen und
keine Zeichenketten.
echo $zufallszahl[0];
Gibt z. B. die erste Zufallszahl aus.
Assoziative Arrays
In diesem Abschnitt werden die zuvor angetroffenen assoziativen
Arrays vorgestellt. Auch in PHP gibt es die Möglichkeit, eine Art
„Übersetzung“ zu speichern. Angenommen, man hat ein
assoziatives Array $benutzer. In $benutzer werden verschiedene
Werte abgespeichert, auf die man mithilfe der eckigen Klammern und
einem sogenannten Schlüssel dazwischen zugreifen kann:
$benutzer[SCHLÜSSEL]. $benutzer kann man als Datensatz einer
Datenbank ansehen. Ihm können beliebig viele Informationen zugeordnet
werden, immer über die eckigen Klammern und den Schlüssel, z. B:
$benutzer['betriebssystem']
$benutzer['geburtstag']
$benutzer['lieblingsessen']
Außerdem kann man assoziative Arrays für alles verwenden, was
irgendwie „übersetzt“ werden muss:
$hauptstadt["Schweiz"] = "Bern";
$franz["das Dorf"] = "le village";
Zur Übersetzung von Wörtern zwischen Sprachen, hier ein kurzes
Beispiel:
<?php
// Definiere Wortschatz:
$englisch = array("Buch" => "book", "Kabel" => "cable", "Kuh" => "cow");
// Lese das übergebene Wort ein:
$de_wort = $_GET['wort'];
// Gib die Übersetzung aus:
echo $englisch[$de_wort];
?>
Man ruft das Skript dann mittels uebersetzung.php?wort=Buch auf
und erhält:
book
In der dritten Zeile wird das Array definiert. Hier werden der
Funktion aber Parameter übergeben. Diese werden speziell
getrennt. An erster Stelle kommt der Schlüssel, über den auf den
nach dem Pfeil folgenden Wert zugegriffen werden kann. Das
wiederholt sich für jeden Eintrag im Array. Die einzelnen Einträge
werden durch Kommas abgetrennt. Hier wieder ein Beispiel:
"schluessel" => "wert", "schluessel2" => "wert2", "schluessel3" => "wert3"
Sicherlich kann man auch auf die Idee kommen, dem Skript ein Wort zu übergeben,
das gar nicht definiert ist. So wird mit dem Aufruf
uebersetzung.php?wort=Tisch gar nichts ausgegeben, da die Variable
$englisch['Tisch'] nicht existiert. Mit isset() kann man aber
überprüfen, ob eine Variable vorhanden ist oder nicht:
<?php
// Definiere Wortschatz:
$englisch = array("Buch" => "book", "Kabel" => "cable", "Kuh" => "cow");
// Lese das übergebene Wort ein:
$de_wort = $_GET['wort'];
// Überprüfe, ob das Wort im Array vorhanden ist
if(isset($englisch[$de_wort])){
// Wenn ja, gib die Übersetzung aus:
echo $englisch[$de_wort];
} else {
// Sonst, gib aus:
echo 'Ich kenne das Wort nicht!';
}
?>
Wer jetzt verstanden hat, was assoziative Arrays sind, wird sicher
erkennen, dass $_GET und $_POST nichts anderes als assoziative
Arrays sind. Nicht wesentlich anders sieht es im nächsten Abschnitt
aus.
PHP-Sessions
PHP-Sessions sind Sitzungen, die meist nach einem Log-in mit dem
Server aufgebaut werden, damit dieser einen später auf anderen Seiten
wiedererkennen kann. Wenn man sich einloggt, möchte man nicht, dass
man sich nach jedem Klick auf einen Link wieder einloggen muss. Dazu
wird eine 32 Byte lange, zufällige Kombination aus
Hexadezimalzeichen erstellt. Der Computer des Benutzers, der sich gerade
eingeloggt hat, speichert diese in einer kleinen Datei (genauer
gesagt in einem Cookie). Wenn der Anwender das nächste Mal einem
Link folgt, wird die kleine Datei mit dem Aufruf der Seite
mitgesendet. Dadurch kann der Server diesen Benutzer eindeutig
identifizieren. Damit der Browser die Cookies akzeptiert und
abspeichert, müssen sie in den Einstellungen aktiviert sein.
In einer Session können beliebig viele Informationen in einem
assoziativen Array abgespeichert werden. Das Array dazu lautet
$_SESSION. Wer mehr über Sessions erfahren möchte, findet
Informationen im entsprechenden Wikipedia-Eintrag
[2]. Informationen über die
Sicherheit findet man im PHP-Manual [3].
Damit PHP übermittelte Session-Cookies einliest oder dem Client
eine neue ID zuteilt, muss jede Seite, bei der man auf
die Session-Daten Zugriff haben möchte, mit einem
session_start();
gestartet werden. Da dies eine Funktion ist, die auf den
Protokollheader zugreift, muss sie vor jeder Ausgabe ausgeführt
werden. Ich persönlich schreibe die session_start() immer gleich
nach dem <?php. Das bereitet am wenigsten Probleme. Hier ein
Beispiel:
php3_session.tar.gz
In der Datei erfassen.html befindet sich das Formular, über das
der Name mitgeteilt wird. Dort wird zuerst
überprüft, ob bereits ein Name gesetzt ist, dann wird dieser mit dem
angegebenen Namen überschrieben. Folgt man zu seite2.php wird dort
der Name angezeigt, sofern er gesetzt ist. In logout.php wird die
Session zuerst eingelesen, damit sie eine Codezeile später zerstört
werden kann. Die Session muss immer zuerst gestartet werden, damit
sie beendet werden kann. Mit dem Zerstören der Session gehen alle in
$_SESSION gespeicherten Daten verloren! Gerne kann man in diesem
Beispiel auch zwischen den Seiten herumhüpfen, also einfach mal auf
logout.php gehen, obwohl man nicht eingeloggt ist. Das Skript ist gegen
solche Spielereien geschützt, indem es mit isset() die gesetzten
Variablen überprüft.
Sicherheit in PHP-Skripten
Wie man sieht, ist der Gebrauch der Funktion isset() sehr wichtig.
Sie ist fast immer nötig, damit keine unschöne Fehlermeldung
in der Webseite angezeigt wird, wenn eine Variable nicht gesetzt ist. Ein
häufiger Fehler ist die unterschiedliche Schreibweise von zwei
Variablen (z. B. $pw und $passwort). Und dabei stößt man langsam
auf ein Problem der Programmiersprache PHP. Die Existenz von
Variablen ist nicht sicher. In einem C-Programm kann man sicher
sein, dass Variablen existieren – auch wenn sie keinen brauchbaren
Wert haben. Sie können normalerweise nicht einfach gelöscht werden.
Der Zugriff auf undefinierte Variablen kann, je nach deren Wichtigkeit,
ein PHP-Skript zum Scheitern bringen. Deshalb sollte man
bei allen Variablen, die der Nutzer irgendwie beeinflussen kann (nicht
eingeloggt sein oder die GET-Variablen, bzw. die URL-Zeile
modifizieren), deren Existenz überprüfen.
Wichtig ist außerdem, dass man Eingaben, die irgendwo per echo
ausgegeben werden, filtert. Gibt man als Name in einem Formular
HTML-Code ein, wird dieser per echo auf die Seite geschrieben, und
der Browser interpretiert das HTML. Der Benutzer kann also HTML
einfügen und interpretieren lassen. Es kann weitaus mehr passieren,
wenn JavaScript-Code eingefügt wird. Dieser könnte zum Beispiel auf
eine mit Schadcode behaftete Webseite weiterleiten. Am besten ist
es, den HTML-Tag-Anfang (<) zu filtern, denn dann werden HTML-Tags
nicht mehr interpretiert. Um eine Zeichenkette zu ersetzen, kann man
str_replace benutzen.
<?php
echo "<!DOCTYPE html>
<html><body><p>";
$test = $_GET['xsstest'];
$test = str_replace("<", "<", $test);
$test = str_replace(">", ">", $test);
echo "Die Eingabe war $test";
echo "</p></body></html>";
?>
Bei < und > handelt es sich um HTML-Zeichen für „kleiner
gleich“ und „größer gleich“.
Natürlich bietet PHP eine einfachere Funktion:
<?php
$test = htmlspecialchars($_GET['xsstest']);
echo "Die Eingabe war " . $test;
?>
Fazit
Nach diesem Abstecher in die PHP-Sicherheit sollte man sich merken,
dass man in PHP alles filtern und überprüfen sollte. PHP ist keine
Programmiersprache für Programmierer, die ein sicheres Programm
möglichst „rasch“ schreiben wollen. Aber: Alle Programmierer machen
irgendwo Fehler.
Links
[1] http://www.freiesmagazin.de/freiesMagazin-2011-11
[2] http://de.wikipedia.org/wiki/Session-ID
[3] http://www.php.net/manual/de/session.security.php
| Autoreninformation |
| Patrick Eigensatz (Webseite)
befasst sich seit einigen Jahren mit der Entwicklung von
Webanwendungen und hat dadurch viele Erfahrungen im Bereich PHP
gesammelt.
|
| |
Diesen Artikel kommentieren
Zum Index
von Herbert Breunung
Viele wichtige Perlvokabeln wurden bereits in den Teilen 1 bis 3
beschrieben und angewendet. Es ist also Zeit, einen Gang runter zu
schalten, um Details zu betrachten, die bisher überflogen wurden.
Zum Beispiel werden Arrays und Hashes gründlicher verglichen und
wesentliche Ausgabehilfen vorgestellt. Ziel dieses Textes ist es
aber zu zeigen, wie sie sich wie Legosteine kombinieren lassen, um
die Datentürme noch höher und breiter zu bauen. Das Demoprogramm
wird dafür kurzfristig in den Hintergrund treten.
Nachträge
Eigentlich stünde der letzten Folge der Titel „String- und
Listenmanipulation sowie Hashes“ wesentlich besser, denn weder
Schleifen noch Subroutinen wurden groß erörtert. Dafür aber beide
Möglichkeiten der bedingten Ausführung (if und when).
for-Schleifen wurden erläutert, aber es gibt noch zwei weitere
Arten: while und until. Rein logisch verhalten sie sich wie if
und unless. Bei einer einfachen if-Anweisung (ohne elsif oder
else) wird der Block ausgeführt, wenn die Bedingung einen
positiven Wert (nicht 0, leer oder undef) zum Ergebnis hat. Ebenso
verhält sich while. Nur prüft es danach wieder die Bedingung,
sooft bis sie einmal negativ ausfällt. Erst danach wird der Block
nicht mehr ausgeführt. Damit lassen sich also Programme schreiben,
die niemals ein Ende finden. Manchmal ist das allerdings erwünscht.
Dann wird oft so etwas geschrieben:
while (1) {
say "Ich dreh hier schon seit Stunden ...";
}
until funktioniert genauso, verneint (wie mit not) nur das
Ergebnis der Bedingung, so wie unless es auch tut. Es führt
solange den Block aus, bis die Prüfung positiv ausfällt.
Lustigerweise kennen fast alle Sprachen (bis auf Python) until,
aber neben Perl nur wenige (wie Ruby) auch unless.
Und die im Einleitungsteil gepriesene derzeitige Umgestaltung der
Infrastruktur schritt auch seit freiesMagazin 07/2011
[1] gut voran. Die
damals aufgezählten CPAN-Dienste, wie etwa Bewertungen oder die
Testmatrix, die über mehrere Seiten verstreut sind, können jetzt
über die MetaCPAN-Seite [2] auf der
Hauptseite jedes Moduls in zwei Spalten überblickt werden. Welche
Module das angezeigte benötigen, wird aufgelistet. Sogar die
Entwicklung der Quellen ist dort graphisch dargestellt und es lässt
sich einfach in den Versionsunterschieden blättern. Die Suche
wurde bequemer, da wie von Google gewohnt, während des Tippens
Vorschläge unterbreitet werden. Die Modul-URL wurden ebenfalls kürzer
und prägnanter. Auch das Angebot von PrePAN [3]
wird gerade vom MetaCPAN aus verknüpft. Auf dieser kürzlich erst
gegründeten Seite können Entwickler und Interessierte über
vorhandene und geplante (daher der Name „Pre“) Module diskutieren.
Wem die Gelegenheit fehlt, die ungezählten Perlblogs täglich im
Blickfeld zu behalten, der informiere sich in etwa fünf bis zehn
Minuten mit der wöchentlichen Rundmail von Perl Weekly [4],
die Gabor Szabo nun versendet. Sie ist lesbarer und informativer als
die Übersichten der letzten wichtigereren Blog-Beiträge, die Andy
Lester auf Perlbuzz [5] zusammenträgt.
Der letzte Neuzugang ist das Perl Tutorial Hub [6],
ein Zentralregister für alle Lehrmaterialien zu Perl, welche dort
sortiert und bewertet werden. Auch dieses Tutorium wurde dort
bereits erfasst, aber noch nicht bewertet.
Variablen
Das Thema Variablen ist in Perl so simpel wie möglich gehalten. Jede
skalare Variable kann ohne Voranmeldung alles aufnehmen, egal ob
Zahlen, Texte, Entscheidungen, Suchmuster oder Programmteile. Es ist
auch nicht wichtig, wie groß die Daten sind oder ab wann sie nicht
mehr gebraucht werden. Der Interpreter regelt die technischen Details.
Manchen gefällt nur nicht, dass Variablen mit $, @ oder % anfangen
müssen. Aber anderen Menschen fällt es so leichter, Variablen
wiederzuerkennen. Ebenso kann Perl (wie im letzten Teil gezeigt)
damit die Variablen in jeder Lage (wie etwa innerhalb
Anführungszeichen) ohne Zusätze und Verrenkungen wiedererkennen. Die
Systemadministratoren waren das eh von ihrer Shell gewohnt. Außerdem
erlaubt es eine Variable $read_file zu haben haben, die keine
Probleme mit der Funktion read_file() des Moduls File::Slurp hat.
Wobei $read_file kein wirklich guter Variablenname ist. Gute Namen
beschreiben den Inhalt so genau wie möglich, wie etwa $maerchentext
oder $laenge_in_m. Das ist eine wesentliche Zutat für Programme, die
auch noch nach Jahren verständlich bleiben.
$read_file wäre schon deshalb kein guter Variablenname, weil er
eine Tätigkeit beschreibt. In Programmen sind es aber eher die
Funktionen (in Perl Subroutinen genannt), welche für Handlungen
stehen und damit die Rolle von Verben haben. Die Variablen zeigen
womit und wie gehandelt wird. Sie sind die Substantive und
Adjektive. Nicht jeder sieht das so, aber der Linguist Larry Wall
schon. Für ihn symbolisieren $ und @ die Einzahl- und
Mehrzahl-Endungen der Substantive. Deshalb bekommt man mit @notizen
alle Elemente als Liste. Und deshalb schreibt man auch $notizen[0],
um das erste Element zu erhalten, was nichts mit einer vielleicht
existierenden Skalarvariable $notizen zu tun hat. Bei Notiz eins und
zwei heißt es wieder @notizen[0,1]. % ist nur eine besondere
Mehrzahl, bei der die Glieder in Paaren auftreten. Dieses Konzept
war bis Perl 4 sinnvoll. Ab Perl 5 bereitet es Einsteigern darüber
hinaus einige Schwierigkeiten, die erst ab vorigem Jahr mit 5.14
langsam abnehmen. Die Ursache dafür sind Referenzen, die neben
Modulen wohl wichtigste Neuerung, die Perl 5 vor 17 Jahren brachte.
Seit es sie gibt, verschwand die Garantie, das $ für einen
Einzelwert steht.
Einfache Referenzen
Kommt ein Postbote an die Haustür und liest dort: „Achtung! Mieter
verzogen – die neue Anschrift ist Nymphenweg 10, 1234 Lärchenhain“,
weiß er, wohin das Paket gehen soll. Mit den Referenzen ist das
ähnlich. Das sind Adressen die besagen: „Was du suchst, ist dort
drüben in der Speicherzelle für Skalare Nummer soundso.“ Das heißt
dann ausgeschrieben SCALAR(0x8c82eb0). Im normalen Gebrauch sind
Referenzen aber recht einfach.
my $original = "Alles paletti Egon.";
my $kopie = \$original;
Der Backslash erzeugt die Referenz auf das was ihm folgt. In
$kopie ist damit eine Referenz auf $original. say $kopie;
bestätigt das mit der Ausgabe von SCALAR(0x........). Um die
Referenz aufzulösen, also der Adresse nachzugehen muss ein weiteres $
vor $kopie gesetzt werden.
say $$kopie; # Alles paletti ...
Bereits das erste Dollarzeichen besagte: „Schau nach, ob du im
Zentralregister (Symboltabelle) unter dem Namen kopie eine
Skalarvariable findest und gib mir den Inhalt.“ Das Ergebnis ist die
erwähnte Adresse ohne schönes, selbstgewähltes Pseudonym. Das zweite
$ schickt den Boten erneut mit der erhaltenen Adresse und dem
gleichen Befehl los, worauf der zu berichten weiß, dass alles paletti
ist. Um herauszubekommen welcher Art die Referenz ist, gibt es den
Befehl ref:
say ref $kopie;
Das gibt SCALAR aus, den meistens interessanten Teil der Adresse.
Wie einfach zu erraten ist, antwortet der Befehl in anderen Fällen
ARRAY oder HASH.
say ref \@notizen'; # ARRAY
say ref \%kommando'; # HASH
ref $$kopie liefert gar nichts (einen leeren String, kein undef).
$$kopie, gleichbedeutend mit $original, enthält nämlich keine
Referenz, sondern einen einfachen Wert. In manchen Programmen werden
nur die $kopie verwendet, aber nicht das $original. Da mag sich
mancher wundern, warum man nicht gleich
my $kopie = \"Alles paletti Egon.";
schreibt. Die Antwort ist, weil es ein Sonderfall ist. Das erzeugt
eine Referenz auf einen konstanten Wert und nicht auf eine Stelle im
Speicher. Wer dennoch versuch $$kopie zu ändern, ohne ein $original
anzulegen, wird sofort mit einem Programmabbruch belohnt, gekrönt
von der Meldung: „Modification of a read-only value attempted at …“
Referenzen auf Arrays
Interessanter wird es, wenn die Referenz auf einen Array zeigt.
Dafür stehen zwei Wege zur Auswahl:
my @primzahlen = (2,3,5,7,11,13;17);
my $aref = \@primzahlen;
my $aref = [2,3,5,7,11,13,17];
say ref $aref; # sagt: "ARRAY"
say "@$aref"; # "2 3 5 7 11 13 17"
Um diese Referenz aufzulösen, braucht es wieder das passende Sigel.
Gut, dass mit ref nachgefragt wurde, welcher Art die die Referenz
war. Aber kann man so auch ganz normal auf das Array zugreifen?
Eindeutig: Ja! Sogar ohne dass man das Sigel noch dazu verändern
müsste, wenn man ein oder mehrere Elemente des Array anspricht. @$pref[....]
wäre in jedem Fall korrekt. Der übliche Dienstweg ist
aber ein anderer, nämlich der Pfeil-Operator:
say @$pref[1]; # zweites Element
# ist 3
say $pref->[1]; # dito
$pref->[1] = "darf ich?";
Und dieses Mal läuft Perl wie am Schnürchen, da bei Arrays und
Hashes die referenzierten Inhalte nicht als Konstanten angelegt
werden. Die dafür zu verwendenden Klammern lassen sich einfach
merken. Eckige Klammern erzeugen eine Referenz auf ein Array der
umschlossenen Werte. Denn um Teile (Slices) eines Arrays zu bekommen,
nimmt man auch die eckigen. Genauso einheitlich ist die Verwendung
der geschweiften Klammern bei Hashes.
Wie bereits angedeutet, kann man sich ab Perl 5.14 das
Dereferenzieren in einigen Situationen sparen. Auf deutsch: Wenn
Befehle, die eh nur bei Arrays sinnvoll sind, einen Skalarwert
bekommen, schauen sie nach, ob es eine Referenz auf einen Array ist.
Im Beispiel:
# nächste Primzahlen zufügen:
push @$pref, 19, 23;
# mit use v5.14; :
push $pref, 19, 23;
Neben push kann das auch noch pop, shift, unshift, splice,
keys, values und each Verwendung finden. Die letzten drei lösen
auch Hashref auf.
Referenzen auf Hashes
Fast alles über Arrayreferenzen Gesagte ließe sich noch einmal für
Hashreferenzen wiederholen.
my %autoren = (
mjd => 'hop', dc => 'pbp', c => 'mp'
);
my $href = \%autoren;
my $href = {
mjd => 'hop', dc => 'pbp', c => 'mp'
};
say $href->{'mjd'} # sagt: "hop"
say ref $href; # sagt: "HASH"
Hashes sind wie Arrays eine Sammlung von Skalarwerten. Nur hat in
einem Hash jeder Wert einen vom Programmierer gewählten Namen, der
erst einmal als Text verstanden wird und keine Nummer wie im Array.
Diese Namen (Schlüssel) besitzen auch keine feste Reihenfolge.
Deshalb wäre es fruchtlos, splice auf einen Hash anzusetzen. Um ein
Paar zu löschen, bedarf es nur einem
delete @g{'mjd'};
Die kryptisch anmutenden Inhalte des Hashes sind
Literaturempfehlungen. Mark Jason Dominus schrieb „High Order Perl“
um zu zeigen, dass Perl sehr gut als funktionale Programmiersprache
taugt. Damian „larrys evil henchman“ Conway gab mit „Perl Best
Practice“ eine vielbeachtete Stilvorgabe und chromatic schrieb vor
zwei Jahren „Modern Perl“, um zu unterstreichen, was heute den
meisten anderen Büchern fehlt.
Arrays ausgeben
Man sollte hier aber noch einmal einen Blick zurück werfen:
say "@$aref";
#sagt "2 3 5 7 11 13 17"
Auch ein say "@notizen"; setzt klärend Leerzeichen zwischen die
Inhalte der Elemente. Wer lieber Bindestriche hätte, erreicht das
mit einem vorherigen local $" = '-'; Es gibt auch noch die magische
Variable $, die im Normalfall , also keinen Text, beinhaltet. Würde
man sie mit einem Leerzeichen füttern,
local $, = ' ';
say "Ihre Nachricht:", $notiz;
würde dieses ' ' zwischen Ihre Nachricht: und dem Inhalt der $notiz
eingefügt werden.
Manche halten jedoch die Verwendung von „magischen” Spezialvariablen
für ein Werk der Finsternis. Natürlich kann sie unerwünschte
Nebeneffekte haben, wie bereits im Teil 2 (Abschnitt „Lösung
der Aufgabe“) erläutert. Verändert man aber (wie in diesem
Beispiel) mit local nur eine lokale Kopie der Variable, deren
Lebensdauer bis zum Ende des aktuellen Blocks reicht, werden die
Nebeneffekte vermieden. Wem es dennoch verboten ist oder wer es für böse
hält, kann den Effekt von local $" = '-' auf einem anderen Weg
erzielen:
say "Ihre Nachrichten: ",
join( '-', @primzahlen );
# sagt: "2-3-5-7-11-13-17"
join ist das Gegenteil des im letzten Teil vorgestellten split.
split bekam als ersten Parameter ein Textstück oder Suchmuster und
teilte anhand dessen den Inhalt des zweiten Parameters in Teile. Das
Ergebnis war ein Array. join kann die Teile wieder verbinden und
zwischen sie wieder die entnommenen Trennzeichen fügen.
Hashes ausgeben
Mit
say "%$href"; # sagt: "%$href"
erhält man den ungewollten, unschön formatierten Ausdruck von
Hashdaten. Damit ist Perl 5 auch etwas überfordert. Um den Inhalt
von Hashes übersichtlich aufzulisten, gibt es das Modul Data::Dumper:
use Data::Dumper;
print Dumper( $href ); # oder:
print Dumper( \%autoren );
Dies gibt aus:
$VAR1 = {
'c' => 'mp',
'dc' => 'pbp',
'mjd' => 'hop'
};
Wem das zu viel Platz wegnimmt und wer nicht für jede öffnende oder
schließende Klammer und jedes Wertepaar eine Zeile nutzen will,
der nehme Data::Dump. Das spart auch das print, \n oder say,
verlangt aber vom Benutzer, das Modul erst
einmal zu installieren. Data::Dumper ist im Unterschied dazu immerhin
ein Kernmodul und bei jedem Perl von Anfang an dabei.
use Data::Dump qw(dump);
dump(\%autoren);
# sagt: { c => "mp", dc => "pbp", mjd => "hop" }
Dieses Format ist das von Perl. Und (wie auch Data::Dumper)
besonders praktisch, wenn man überprüfen will, was das Programm
gerade macht und welche Daten wirklich in der Variable stecken, oder
ob sich ein Fehler eingeschlichen hat. Wenn man Hashes oder noch
Komplizierteres in eine Datei ablegen will, um sie beim nächsten
Programmstart wiederherzustellen, gibt es andere Module für diese
Arbeit. Die bekanntesten sind JSON und YAML. Das sind beides
international verbreitete Standards, für die viele Sprachen auch
Bibliotheken haben, so auch Perl. Für das Notizprogramm wäre YAML
geeigneter. Es ist mächtiger und kann sogar Strukturen erkennen, in
denen zwei Referenzen auf die gleiche Speicherstelle zeigen.
Arrays von Arrays (AoA)
Bisher konnten die Referenzen nicht ihren vollen Nutzen zeigen. Mit
einem einzelnen Zeiger auf einen Array beeindruckt man keinen
praktisch denkenden Menschen. Was wäre aber, wenn jeder Wert eines
Arrays auf einen anderen Array zeigt. Dann hätte man nicht nur eine
Zeile von Werten sondern eine Fläche. Es ist wie das
Koordinatensystem im Mathe-Unterricht. Zuerst kommt die X-Koordinate
(Spalte, Nummer im Oberarray) und dann Y (Zeile, Nummer im
Unterarray). Für ein kleines 3x3-Feld wäre das:
my $magisches_quadrat = [
[8,1,6],
[3,5,7],
[4,9,2],
];
Der zweite Wert des ersten Arrays ist 1 (der Koordinatenursprung
liegt links oben). Um ihn zu erreichen, schreibt man
say $magisches_quadrat->[1]->[0];
# sagt: 1
say $magisches_quadrat->[1][0];
# sagt: 1
Den zweiten Pfeil kann man weglassen, da Perl auch so weiß, was
gemeint ist. Nur den ersten Pfeil muss man dazu schreiben, um
Zweideutigkeiten zu vermeiden. Folgendes ist ein völlig anderer
Ausdruck:
say $magisches_quadrat[0][0];
Das erste Beispiel war ein Skalar, der auf ein Array zeigt. Im
zweiten Beispiel bekommt man ein Element eines Arrays. Zufällig ist
es eine Array-Referenz, von der wiederum das erste Element verlangt
wird. Das ist eine Struktur, die so definiert wurde:
my @magisches_quadrat = (
[8,1,6],
[3,5,7],
[4,9,2],
);
Jetzt lichtet sich auch der Nebel um die Aussage, dass Referenzen die
Bedeutung der Sigel stören. $magisches_quadrat[0] sieht nach
einem Skalar aus, ist aber in Wirklichkeit ein Array. Oder zumindest
eine Referenz auf einen Array.
Richtig unelegant wird es, möchte man das Array, auf den $magisches_quadrat[0] zeigt, in eine andere Array-Variable kopieren:
my @zeile = @{ $magisches_quadrat[0] };
Hier reicht es nicht, den gewollten Kontext zu erzwingen, indem man
nur ein @ davor setzt wie bei @$aref. Die geschweiften Klammern
müssen klarstellen, dass nicht $magisches_quadrat, sondern
$magisches_quadrat[0] in den Array-Kontext gesetzt werden muss. Jetzt
kann das = die Brücke spannen und Klone der Schäfchen auf der
Weide rechts wandern brav über den Bach in @zeile hinein.
my $zeile = $magisches_quadrat[0];
Das wäre zwar einfacher, aber in dem Fall erhält man nur die
Adresse einer Zeile (Unterarray) in @zeile.
Wird ein Schubfach von $zeile->[0] aus entleert, gibt es
auch nichts mehr von $magisches_quadrat[0][0] aus gesehen.
Hashes verstöpseln
Hashes in Hashes, Hashes in Arrays, gerichtete Graphen, die Wege
über Königsberger Brücken, fast jede erdenkliche Datenstruktur kann
gebaut werden, wenn man nach den gleichen Regeln auch Referenzen auf
Hashes verwendet. Als abschließendes Beispiel sei eine Struktur
erzeugt, die Spielstände eines Schachspiels speichern kann. Dazu
braucht es einen Hash mit den Schlüsseln A bis H (die Spalten).
Jeder Wert ist eine Referenz auf ein Array der Länge 8 (0..7, die
Zeilen). Natürlich könnte man auch ein Array mit Hash-Referenzen
aufziehen, aber so lässt sich später schreiben:
say $feld{'A'}[3];
# sagt: "Dame"
Das entspricht der gewohnten Sprache der Schachspieler und erzeugt
weniger Verwirrung. Hochtrabend wird dieses Prinzip auch
„Domain-Driven Design“ (DDD) genannt und sagt eigentlich nicht mehr
als: „Schreibst du für jemand ein Programm, dann verwende seine
Logik und seine Fachvokabeln.“
Perl hat die wunderbare Eigenschaft, eine solche Struktur nicht
vorbereiten zu müssen. Nach einem simplen my %feld; könnte man die
Abfrage $feld'A'[3]; machen und bekommt nur ein korrektes undef
als Ergebnis. Man ist hier halt weniger streng als anderswo. Während
dieser Aktion geschah aber heimlich, still und leise noch etwas, was
Außenseiter nicht erwarten. Um im Unterarray nachsehen zu können,
wurde im Hash der Schlüssel A angelegt und in seinem Wert die
Referenz auf einen ebenfalls neu erschaffenes, leeres Array
abgelegt. In kaum einer anderen Sprache gibt es diese
„Autovivifikation“. Sie erlaubt unvorbereitete Zuweisungen wie
$feld'D'[55] = 'Läufer';, sagt aber leider auch niemals nein,
selbst wenn eine Zeile 55 ausgesprochen unerwünscht ist.
Noch ein letzter Hinweis: Ist es dennoch gewünscht, die beschriebene
Datenstruktur aufzubauen, sind for und ähnliche Befehle sehr
nützlich. Anstatt alles auszuschreiben
my %feld = (
A => [0,1,2,3,4,5,6,7],
B => [0,1,2,3,4,5,6,7],
...
lässt sich das auch kürzer schreiben. Auch in der Lage kann 0..7
das 0,1,2,3,4,5,6,7 ersetzen. Darüber hinaus funktioniert der
Bereichsoperator .. auch mit Buchstaben. 'A'..'H' erzeugt
ein Array mit den gebrauchten Spaltennamen, der mit for
abgearbeitet werden kann:
my %feld;
$feld{ $_ } = [0..7] for 'A' ..'H';
Nur bitte das my %feld; nicht vergessen, use strict; ist
aktiviert (siehe Teil 1). Auch die Schleife ist notwendig, um
acht verschiedene Arrays zu erzeugen. Eine Lösung mit x wäre in
diesem Falle wirklich nix:
@feld{'A'..'H'} = ([0..7]) x 8;
Der Wiederholungsoperator kopiert nur die einmal erzeugte Referenz
und alle acht Hash-Schlüsseln würden auf den selben Array zeigen, wie
eine schnelle Überprüfung per say Dumper(%feld); (Data::Dumper)
auch zeigt:
$VAR1 = {
'F' => [
0,
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7
],
'A' => $VAR1->{'F'},
'E' => $VAR1->{'F'},
'B' => $VAR1->{'F'},
'H' => $VAR1->{'F'},
'C' => $VAR1->{'F'},
'D' => $VAR1->{'F'},
'G' => $VAR1->{'F'}
};
Ausblick
All das war eine lange Vorrede, weil die Nachrichten nicht mehr
länger in einer einfachen Liste (Array) gelagert, sondern nach
Themen oder Wichtigkeit sortiert werden sollen. Wer mag, kann
versuchen, diese Anforderung allein zu implementieren,
bevor in der nächsten Ausgabe die Auflösung erfolgt.
Links
[1] http://www.freiesmagazin.de/freiesMagazin-2011-07
[2] https://metacpan.org/
[3] http://prepan.org/
[4] http://perlweekly.com/
[5] http://perlbuzz.com/
[6] http://perl-tutorial.org/
| Autoreninformation |
| Herbert Breunung (Webseite)
ist seit sieben Jahren mit Antworten, Vorträgen, Wiki- und
Zeitungsartikeln in der Perlgemeinschaft aktiv. Dies begann mit dem
von ihm entworfenen Editor Kephra,
|
| |
Diesen Artikel kommentieren
Zum Index
von Daniel Nögel
Im letzten Teil der Python-Reihe (siehe freiesMagazin 10/2011 [1])
wurde die urllib-Bibliothek vorgestellt und damit ein Client für
den FileHoster BayFiles.com implementiert. In diesem Teil soll
das subprocess-Modul vorgestellt werden, mit dem sich Prozesse
starten, Rückgabewerte auslesen und Pipes umsetzen lassen.
Besprechung der Übung
Zunächst soll aber die im letzten Teil vorgeschlagene Aufgabe
besprochen werden. Umgesetzt werden sollte eine Download-Funktion
mit Fortschrittsanzeige, die es auch erlaubt, begonnene Downloads
fortzusetzen.
Eine fertige Beispiellösung findet sich bei GitHub [2].
Einige Besonderheiten sollen im Folgenden besprochen werden.
In Zeile 12 wird die Zieldatei im Modus ab geöffnet. Dies
bedeutet, dass die Datei binär geöffnet wird und neue Daten
angehängt werden
(append). Wenn die Zieldatei bereits vorhanden war (resume in
Zeile 11 also den Wert True zugewiesen bekommen hat), wird in
Zeile 15/16 zunächst die aktuelle Dateigröße ermittelt. Dies wäre
auch mit der Funktion os.path.getsize möglich, da die Datei hier
aber bereits geöffnet vorliegt, wird mit dem Aufruf fh.seek(0, 2)
die Position auf Byte 0 relativ zum Ende der Datei gesetzt und die
Position (und damit die Größe) mit fh.tell() ermittelt.
Diese Größenangabe wird in den Zeilen 17/18 genutzt, um einen
HTTP-Request zu erzeugen, der die restliche Datei vom Server
anfordert. Der entsprechende Eintrag im HTTP-Header lautet dann
beispielsweise Range: bytes=100-. Wenn der Fehler 416 geworfen
wird, bedeutet dies, dass die lokale Datei bereits vollständig ist
und der Server keine weiteren Daten bereit hält. In diesem Fall gilt
der Download als abgeschlossen (Zeilen 22-25).
In den Zeilen 27-34 wird zunächst die Gesamtlänge des Downloads
ermittelt. Durch die Verwendung des Range-Headers liefert der Server
auf die Frage nach Content-Length allerdings lediglich die
Restgröße des Downloads zurück, sodass die Größe der bereits
heruntergeladenen Daten hinzuaddiert werden muss (Zeile 28). Tritt
hierbei ein Fehler auf, wird die Größe pauschal auf 999999999 Bytes
festgelegt. Eine Lösung, die hier auf Grund der Kürze gewählt wurde.
Schöner wäre es beispielsweise, in diesen Fällen die Größe auf -1
zu setzen und weiter unten im Code statt einer Fortschrittsanzeige
die Meldung „Gesamtgröße konnte nicht ermittelt werden“ anzuzeigen.
Der Code-Block in den Zeilen 35-41 wird ausgeführt, wenn die
Zieldatei noch nicht vorhanden war. Auch hier wird die
Download-Größe ermittelt und im Fehlerfall auf 999999999 gesetzt.
In den Zeilen 43-49 findet der eigentliche Download statt. Der
Ausdruck while content ist so lange wahr, wie der Aufruf
wh.read(blocksize) in den Zeilen 43 und 46 Daten vom Server
zurückliefert und an den Namen content bindet. Die gelesenen Daten
werden mit einem Zähler hochgezählt (Zeile 45) und in die Zieldatei
geschrieben (Zeile 46). In den Zeilen 47 und 48 wird schließlich –
wie schon im letzten Teil dieser Einführung – eine sehr einfache
Fortschrittsanzeige umgesetzt.
Da nicht jeder Server die Anfrage Content-Length unterstützt und
auch nicht jeder Server den Range-Header berücksichtigt, bietet
dieses Vorgehen insgesamt durchaus Spielraum für Fehler und
Probleme. Dennoch wird durch das Skript veranschaulicht, wie man
einen derartigen HTTP-Download mit Fortsetzen-Funktion prinzipiell
umsetzen würde.
subprocess
Das subprocess-Modul [3]
ist ein recht mächtiges Werkzeug rund um das Erzeugen von Prozessen.
Damit lassen sich nicht nur Prozesse ausführen, sondern auch
Rückgabewerte und Fehler auslesen, Eingaben senden und Pipes
erzeugen. Es stellt damit eine wichtige Alternative zu der Funktion
os.system dar, die von Anfängern gerne genutzt wird, von der aber
sogar in der offiziellen Python-Dokumentation abgeraten
wird [4].
Statt also beispielsweise einen neuen Tab im Firefox auf diese Weise
zu öffnen
>>> os.system("firefox -new-tab www.heise.de")
0
wird folgendes subprocess-Pendant empfohlen:
>>> subprocess.call(["firefox", "-new-tab", "www.heise.de"])
0
Beide Funktionen führen das gewünschte Kommando aus und geben den
Rückgabewert des Programmes zurück – in diesem Fall jeweils 0. Ein
Unterschied fällt aber direkt ins Auge: Der Aufruf von
subprocess.call erfolgt mittels einer Liste, os.system erwartet
dahingegen eine einfache Zeichenkette. Dieser Unterschied gilt für
die meisten Funktionen im subprocess-Modul: Sie erwarten die
auszuführenden Kommandos und Argumente als Liste. Zwar lässt sich
dies auch umgehen – aus Sicherheitsgründen wird davon
aber abgeraten [5].
Mit shlex.split [6]
gibt es eine Funktion, mit der sich aus einer Zeichenkette bequem
die entsprechende Liste erzeugen lässt, so dass die Nutzung von
subprocess kaum Mehraufwand bedeutet.
Einfache Ausgaben verarbeiten
Nun stellen die beiden Befehle oben sicher einen sehr trivialen Fall
im Zusammenhang mit Prozessen dar. Es soll lediglich ein Programm
ausgeführt werden, etwaige Ausgaben sind nicht von Interesse. Etwas
mehr bietet die Funktion check_output. Mit dieser Funktion lässt
sich die Ausgabe eines Prozesses auslesen:
>>> ret = subprocess.check_output(["wine", "--version"])
>>> print ret
'wine-1.3.32\n'
Hier wird die aktuelle Wine-Version durch den Aufruf von
wine --version ermittelt. Die Ausgabe des Aufrufes wird an den
Namen ret gebunden. Nun könnte beispielsweise überprüft werden, ob
eine bestimmte Wine-Version vorliegt oder eben nicht.
Dies gilt aber nur für den Fall, dass das aufgerufene Programm den
Rückgabewert 0 hatte, also fehlerfrei beendet
wurde [7].
Andernfalls wird die Ausnahme CalledProcessError geworfen. Wird
diese abgefangen, lassen sich weitere Informationen über den Fehler,
inklusive der Fehlerbeschreibung, ermitteln, wenn das Programm eine
solche ausgegeben hat:
>>> try:
... ret = subprocess.check_output(["ls", "/home/nicht-existierender-benutzer"])
... except subprocess.CalledProcessError as inst:
... print inst.output
... print inst.returncode
...
ls: Zugriff auf /home/nicht-existierender-benutzer nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2
check_output eignet sich besonders dann, wenn kleinere Ausgaben
schnell durchlaufender Programme ausgelesen werden sollen und im
Fehlerfall
eine Exception erwartet wird.
Das ist nicht immer der Fall: Manche Programme kodieren über den
Rückgabewert auch zusätzliche Informationen, die nicht unbedingt auf
einen schweren Fehler hinweisen. Da check_output weiterhin erst
wartet, bis der aufgerufene Prozess beendet wurde, ist es in der
Regel auch nicht sonderlich für Programme geeignet, die länger
laufen und dabei kontinuierlich Text generieren, der in Echtzeit
verarbeitet werden soll.
Das Schweizer Taschenmesser
Für die Verarbeitung derartiger Ausgaben eignet sich die Klasse Popen. Sie gewährt Zugriff auf Ein- und
Ausgaben in Form von dateiähnlichen Objekten.
process = subprocess.Popen(["find", "/"], stdout=subprocess.PIPE)
while process.poll() is None:
print process.stdout.readline()
Hier wird das Root-Verzeichnis rekursiv durchlaufen und die Ausgabe zeitnah verarbeitet,
zusätzlich wird der Parameter stdout genutzt. Durch die
Übergabe von subprocess.PIPE wird erreicht, dass die Ausgaben, die
das Programm in die Standardausgabe schreibt, durch Popen
verarbeitet werden. Das Popen-Objekt wird hier an den Namen
process gebunden. Die Methode poll() gibt so lange None
zurück, bis das Programm beendet wurde. Dann gibt es den
Rückgabewert des Programmes zurück. Solange der Aufruf von
process.poll() also None liefert, kann davon ausgegangen werden,
dass find noch läuft. In diesem Fall wird mittels
process.stdout.readline() jeweils eine Zeile des Ausgabe gelesen
und in diesem Fall mit print ausgegeben.
Der direkte Zugriff auf stdout und stderr bringt aber Nachteile mit sich, so besteht etwa die Gefahr sogenannter
„Deadlocks“. Außerdem blockiert beispielsweise die Methode
readline() den Programmfluss so lange, bis tatsächlich eine neue
Zeile in den Ausgabepuffer geschrieben wurde. Würde das aufgerufene
Programm gar keine Ausgabe in die Standardausgabe schreiben, würde
der Programmfluss so lange blockieren, bis das Programm
durchgelaufen ist.
Wo es möglich und sinnvoll ist, sollte daher die Methode
communicate() eingesetzt werden. Diese blockiert zwar ebenfalls,
bis das Programm beendet wurde, liefert dafür zuverlässig und ohne
die Gefahr besagter Deadlocks die gewünschten Ausgaben. Das hier
vorgestellte Vorgehen bietet sich also tatsächlich nur an, wenn die
Ausgabe länger laufender Programme zeitnah bearbeitet werden soll
und etwaige Seiteneffekte ausgeschlossen werden können.
Communicate und Pipes
In ihrer einfachsten Verwendung ist die Methode communicate() eine
Alternative zu der Funktion check_output().
Zum veranschaulichen:
process = subprocess.Popen(["du", "-s", "/etc", "/nicht-existierender-ordner"], stdout=subprocess.PIPE, stderr=subprocess.PIPE)
stdout, stderr = process.communicate()
Hier soll jeweils die Gesamtgröße der Verzeichnisse /etc und
/nicht-existierender-ordner ermittelt werden. Der Inhalt der
Standardausgabe wird dabei an stdout gebunden, der Inhalt der
Fehlerausgabe an stderr.
>>> print stdout
10036 /etc
>>> print stderr
du: kann Verzeichnis "/etc/sudoers.d" nicht lesen: Keine Berechtigung
du: Zugriff auf "/nicht-existierender-ordner" nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Das Programm (du)
wird also ausgeführt.
process.communicate(), wartet, bis das Programm beendet wurde, und
bindet Standard- und Fehlerausgabe dann an die angegebenen Namen.
Mit Popen und communicate() lassen sich auch recht einfach Pipes
realisieren, wie man sie aus der Shell kennt. So liefert das
Programm ps für gewöhnlich Informationen über laufende Prozesse.
Häufig wird die Ausgabe dieses Programms in der Shell an grep
weitergeleitet, um bestimmte Prozesse heraus zu filtern:
$ ps aux | grep firefox
daniel 7322 0.0 3.3 590272 68920 ? Sl 15:53 0:02 firefox
daniel 8257 0.0 0.0 12548 1052 pts/8 S+ 17:27 0:00 grep firefox
Eine derartige Pipe lässt sich auch mit subprocess realisieren:
process1 = subprocess.Popen(["ps", "aux"], stdout=subprocess.PIPE)
process2 = subprocess.Popen(["grep", "firefox"], stdin=process1.stdout, stdout=subprocess.PIPE)
stdout, stderr = process2.communicate()
Hier sind zwei Popen-Instanzen nötig. Die Eingabe der zweiten
Instanz process2 ist die Ausgabe der ersten Instanz process1.
Das ließe sich so prinzipiell beliebig erweitern. So wäre
beispielsweise folgende Kommandozeile denkbar, die direkt die PIDs
der mittels ps aux - grep firefox gefundenen Prozesse ermittelt:
$ ps aux | grep firefox | awk '{print $2}'
7322
8826
Das Pendant in Python sähe wie folgt aus:
process1 = subprocess.Popen(["ps", "aux"], stdout=subprocess.PIPE)
process2 = subprocess.Popen(["grep", "firefox"], stdin=process1.stdout, stdout=subprocess.PIPE)
process3 = subprocess.Popen(["awk", "{print $2}"], stdin=process2.stdout, stdout=subprocess.PIPE)
stdout, stderr = process3.communicate()
Zusammenfassung und Einschränkung
subprocess ist ein mächtiges Werkzeug, wenn es darum geht, externe
Programme zu starten und deren Ausgabe auf verschiedene Weise zu
verarbeiten. Dabei sollte nach Möglichkeit darauf verzichtet werden,
direkt die dateiähnlichen Objekte stdout, stderr und stdin zu
verwenden. Die Methode communicate() sowie die Funktionen
check_output() und call() bieten in der Regel verlässliche
Alternativen, abhängig vom konkreten Anwendungsfall.
Der gerne genutzte shell-Parameter, den Popen und check_output()
kennen, wurde hier nicht besprochen. Er erlaubt es, Befehle wie
ps aux - grep firefox von subprocess durch eine Shell ausführen zu
lassen. So stehen zwar einige erweiterte Funktionen der Shell zur
Verfügung und auch das aufwändige Nachbilden von Pipes bleibt dem
Nutzer erspart; gerade wenn Teile der Kommandozeile aber aus
fragwürdigen Quellen zusammengesetzt werden – etwa mit Zeichenketten
von einer Webseite – kann dies aber zu einer ernsthaften Sicherheitslücke
werden [8].
Schließlich sei noch darauf hingewiesen, dass subprocess sehr gut
geeignet ist, wenn
Programme angesprochen werden sollen, für die es
keine Python-Anbindung gibt. Soll beispielsweise das
Kodierungsprogramm MEncoder aus einem Python-Skript heraus
aufgerufen werden, biete sich subprocess an. In sehr vielen Fällen
ist es aber besser, die Funktionalität einfacherer Programme in
Python nachzubilden oder bestehende Anbindungen zu nutzen.
Statt also find aufzurufen, empfiehlt es sich, ein Verzeichnis mit
os.walk rekursiv zu durchlaufen. Statt die Größe einer Datei mit
du zu ermitteln, sollte os.path.getsize verwendet werden. Und
statt ftp mit subprocess „fernzusteuern“, sollte das Python-Modul
ftplib genutzt werden.
Externe Kommandos und Programme können in vielerlei Hinsicht zu
schwer nachzuvollziehbaren Fehlern führen. Die Programme sind unter
Umständen gar nicht installiert oder nicht in einem Verzeichnis
abgelegt, das in der Umgebungsvariable PATH gelistet wird. Unter
Umständen gibt es unterschiedliche Varianten von Programmen mit dem
selben Namen, wie etwa netcat, das es in mehreren unterschiedlichen Implementierungen gibt. Vielleicht verhält sich
ein Programm auch auf verschiedenen Plattformen unterschiedlich,
erwartet Parameter unter Linux nach Bindestrichen, unter Windows
nach Schrägstrichen.
Aus diesen Gründen sollte das subprocess-Modul mit Bedacht eingesetzt werden. In der Regel lohnt sich eine kurze Suche
nach einer Python-Bibliothek mit der gewünschten Funktionalität.
Links
[1] http://www.freiesmagazin.de/freiesMagazin-2011-10
[2] https://github.com/jbarabbas/Simple-download-function/blob/master/download.py
[3] http://docs.python.org/library/subprocess.html#subprocess-replacements
[4] http://docs.python.org/library/os.html#os.system
[5] http://docs.python.org/library/subprocess.html#security
[6] http://docs.python.org/library/shlex.html#shlex.split
[7] http://en.wikipedia.org/wiki/Exit_status
[8] http://docs.python.org/library/subprocess.html#frequently-used-arguments
| Autoreninformation |
| Daniel Nögel (Webseite)
beschäftigt sich seit drei Jahren mit Python. Ihn überzeugt
besonders die intuitive Syntax und die Vielzahl der Bibliotheken,
die Python auf dem Linux-Desktop zu einem wahren Multitalent machen.
|
| |
Diesen Artikel kommentieren
Zum Index
von Urs Pfister
Dieser Artikel stellt einen portablen KVM-Server mit ArchivistaVM
vor, der von einem USB-Stick auf jedem Rechner in ca. 30 Sekunden gestartet
und in Betrieb genommen werden kann. Dabei muss keine Software
installiert werden, die Software zur Virtualisierung (KVM), ein
X-Server und Web-Server sowie das GUI (Web-Browser) werden komplett
in den Hauptspeicher geladen. Die Gäste werden entweder direkt vom
USB-Stick oder von der Festplatte gestartet. Nach dem Starten
kann lokal (X-Server mit Web-Browser) oder von einem beliebigen
Rechner aus (Web-Browser mit Java-Applets) gearbeitet werden.
Eine Demo, die das Resultat innerhalt weniger Sekunden vorführt, kann man
unter [1] finden. Weiter seien an dieser Stelle
einige Vorteile von ArchivistaVM angeführt:
- In fast jedem Haushalt, in jedem Büro, fast an jeder Ecke gibt es Rechner,
die eben mal stillstehen.
- Jeder Rechner und viele Notebooks bringen heute zumindest eine
DualCore-CPU und 2 GByte RAM mit, was ausreicht. Wirklich Spaß macht
die Lösung ab einer QuadCore-CPU und 4 GByte RAM.
- Ein virtualisiertes OS soll zur Datensicherung gestartet werden.
Weshalb ein System aufspielen, Daten zurückspielen, um den Job
erledigen zu können, wenn die Lösung in 30 Sekunden mit einem
USB-Stick und der Sicherungsplatte zu haben ist?
- Ein KVM-Server vom USB-Stick im RAM arbeitet extrem schnell. Dadurch,
dass die Software ins RAM installiert wird, dauert das Starten nicht
länger, als wenn von Festplatte gestartet würde.
- Geht die Virtualisierung in der Wolke (Cloud) nicht viel einfacher?
Spätestens wenn die Wolke mal das Backup vergisst, ist die
Einfachheit (inkl. Daten) weg.
Nachfolgend wird aufgezeigt, wie ein USB-Stick mit ArchivistaVM
erstellt wird und wie mit dem System gearbeitet werden kann. Weiter
werden die wichtigsten Optionen für automatisierte Setups
vorgestellt. Um diesen Artikel durchzuarbeiten, wird ein USB-Stick
mit mindestens 8 GByte und ein Debian/Ubuntu (oder ArchivistaVM ab
CD) benötigt.
USB-Stick erstellen
Nachfolgend wird das Erstellen eines USB-Sticks oder einer CD-ROM
unter Debian/Ubuntu beschrieben. Die ca. 350 MB große ISO-Datei kann
unter [2] herunterladen werden.
KVM-Server auf CD-ROM
Wem die Installation auf einem USB-Stick zu kompliziert ist, der
kann dennoch mit ArchivistaVM arbeiten, denn der portable KVM-Server
funktioniert auch auf CD-ROM. Allerdings passen CD-Laufwerke nicht in die Hosentasche …
Sofern mit einer CD-ROM gearbeitet wird, kann diese nach dem Brennen
direkt gestartet werden. Dazu ist beim Starten wie untenstehend
dargestellt ram einzugeben:
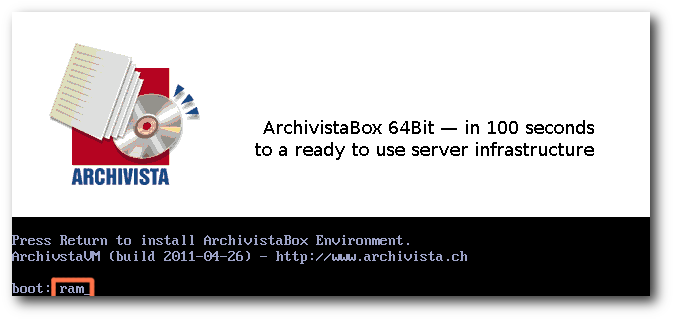
Startbildschirm von ArchivistaVM.
Mit Drücken der Enter-Taste wird das Setup von ArchivistaVM
durchgeführt. Der Vorgang von CD-ROM dauert etwas länger, mehr als
eine Minute dürfte aber nicht notwendig sein, um ArchivistaVM zu
starten. Nach dem Starten kann die CD-ROM entfernt werden. Die CD
wird für das weitere Arbeiten nicht mehr benötigt.
Hinweis: Ohne die Option ram wird das Setup-Programm von
ArchivistaVM gestartet, um das System auf der Festplatte
einzurichten. Spätestens bei der Mitteilung, dass alle Daten
zerstört werden, sollte hier auf „Nein“ geklickt werden …
Einrichten eines USB-Stick
Nach dem Download unter Debian/Ubuntu ist eine Konsole (xterm) zu
öffnen und mit sudo su - wird zu root gewechselt. Zunächst werden
die Pakete lilo und syslinux benötigt. Diese können mit apt-get
install lilo syslinux installiert werden. Danach kann der USB-Stick
eingelegt werden. Wichtig dabei ist, die richtige Adresse des Sticks
zu finden. Dazu kann dmesg verwendet werden.
# dmesg
usb 7-3: new high speed USB device using ehci_hcd and address 15
scsi20 : usb-storage 7-3:1.0
scsi 20:0:0:0: Direct-Access USB Flash DISK 1100 PQ: 0 ANSI: 0
CCS
sd 20:0:0:0: Attached scsi generic sg5 type 0
sd 20:0:0:0: [sdb] 1957888 512-byte logical blocks: (1.00 GB/956 MiB)
sd 20:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
sd 20:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 43 00 00 00
sd 20:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
sd 20:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
sdb: sdb1
sd 20:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
sd 20:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
Auf den zuletzt angezeigten Zeilen findet sich die Adresse des
Sticks. Nun kann der Stick mit cfdisk vorbereitet werden, in
diesem Beispiel ist cfdisk /dev/sdb zu verwenden.
Hinweis: Die nachfolgend verwendeten Einstellungen (/dev/sdb)
können übernommen werden, wenn genau eine Festplatte im System
vorhandenn ist und der USB-Stick als zweites Gerät (sdb)
erscheint. Bei zwei internen Festplatten wäre /dev/sdc zu
verwenden, bei drei Platten /dev/sdd und so weiter. Wird eine
falsche Gerätenummer verwendet, wird ein Datenverlust zu beklagen
sein – und der USB-Stick für ArchivistaVM wird trotzdem nicht
eingerichtet.
Zurück zum Stick, dieser muss bootbar sein und ist mit FAT16 (Typ
06) zu formatieren. Weiter sind drei Partitionen einzurichten:
- Partition Fat 16 (Typ 06) mit 1024 MByte
- Partition Swap (Typ 82) mit 2048 MByte (empfohlen)
- Partition ext3 (Typ 83) mit dem übrigem Platz
Die nachfolgende Abbildung verdeutlicht dies:
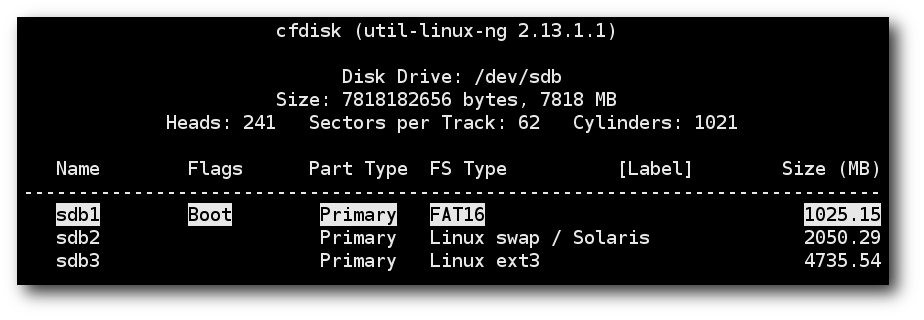
Einrichten der Festplatte mit cfdisk.
Nachdem der Stick initialisiert wurde, können über die Konsole die
restlichen Schritte durchgeführt werden:
# mkdosfs /dev/sdb1
# lilo -M /dev/sdb
# syslinux /dev/sdb1
# mkdir /in
# mkdir /out
# mount -o loop avvm-64bit.iso /in
# mount /dev/sdb1 /out
# cp /in/* /out
# umount /in
# umount /out
Nun sollte der Stick booten und der KVM-Server gestartet werden.
Vorher sollte noch eine Daten-Partition eingerichtet werden. Dies
wird mit mkfs.ext4 /dev/sdb3 erreicht.
Ob es sich lohnt, eine Swap-Partition auf einen USB-Stick zu legen,
muss anhand der Qualität des Sticks entschieden werden. Bei
preisgünstigeren Modellen sollte es eher nicht gemacht werden. Die
Swap-Partiton wird mit mkswap /dev/sdb2 eingerichtet. Mit oder
ohne Swap, der
USB-Stick steht nun zum Arbeiten bereit.
Arbeiten mit dem KVM-Server
Beim Starten ist zu beachten, dass der RAM-Modus aktiviert werden
muss. Dazu ist beim ersten Start-Bildschirm mindestens ram einzugeben.
Hinweis: Ohne die Option ram wird das Setup-Programm von
ArchivistaVM gestartet, um das System auf der Festplatte
einzurichten. Wer dabei unbedacht auf „Ja“ klickt, riskiert, dass
das Setup-Programm die Festplatte zerstört.
Booten des Servers mit ram ramdisk
Bei diesen beiden Optionen wird der USB-Stick so gestartet, dass die
virtualisierten Instanzen direkt auf der dritten Partition des
USB-Sticks gespeichert werden. Das gesamte System (KVM und Images)
liegt auf dem gleichen Stick, es kann hier vom KMV-Server für die
Hosentasche gesprochen werden. Damit einzig mit dem USB-Stick
gearbeitet werden kann, ist beim ersten Prompt wie nachfolgend
dargestellt ram ramdisk einzugeben:

Booten von ArchivistaVM im RAM.
Das System wird nun eingerichtet. Nach einigen Sekunden startet das
Setup-Programm. Die erste Abfrage ist zu bestätigen.
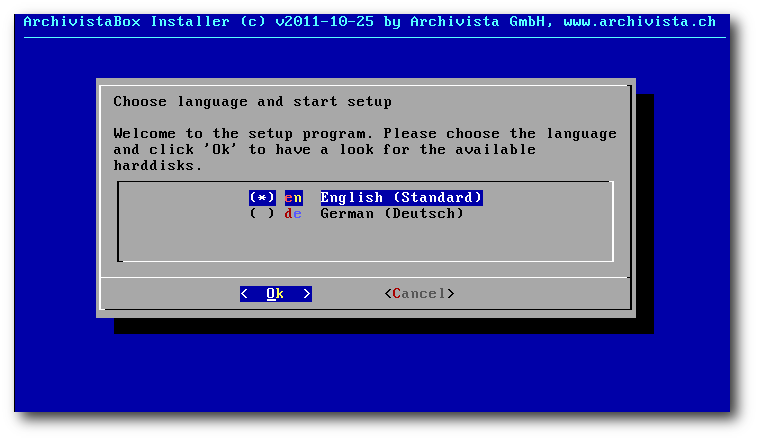
Auswahl der Sprache im Setup.
Nach zwei bis drei Sekunden erscheint eine Liste mit den vorhandenen
Festplatten. Es kann dabei irgendeine Festplatte ausgewählt werden.
Im Modus ram ramdisk erfolgt kein Zugriff auf die internen
Festplatten. Es wird einzig auf diese Platte
zurückgegriffen, sofern
entweder eine CD-ROM oder die Partitionen auf dem USB-Stick nicht
eingebunden werden können (z. B. weil sie gar nicht vorhanden sind).
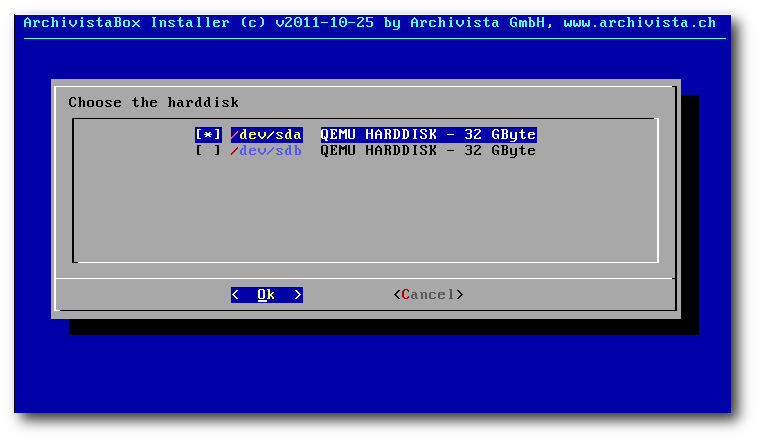
Auswahl der Festplatte zur Installation von ArchivistaVM.
Nach weiteren 10 bis 15 Sekunden erfolgt eine Abfrage für die
gewünschten Netzwerk-Einstellungen. ArchivistaVM verlangt nach einer
fixen IP-Adresse (ein Server für die Virtualisierung ist nicht
unbedingt sinnvoll ohne feste IP-Adresse). Dabei sind die Daten
analog zur Abbildung einzugeben:
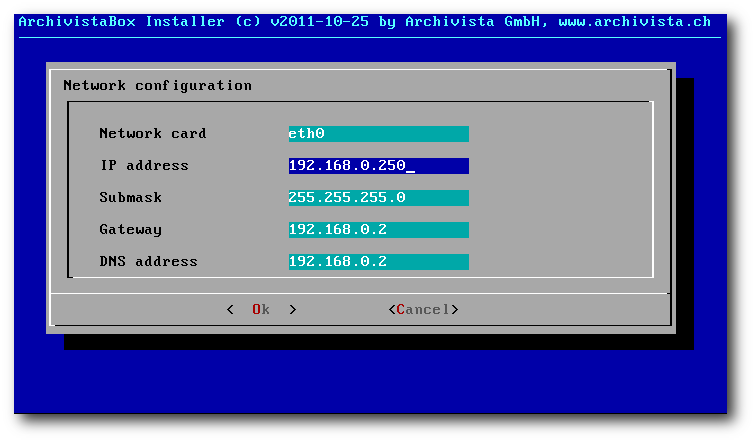
Einstellen der Netzwerkkonfiguration.
Hinweis: Sollte keine eindeutige Netzwerkadresse vorhanden sein, so
kann beim Computer das Netzwerkkabel abgehängt werden. Dann kann die
voreingestellte Adresse 192.168.0.250 problemlos verwendet werden.
Ein Arbeiten mit ArchivistaVM ist auch ohne Netzanschluss lokal
möglich.
Nach weiteren ca. 5 Sekunden erscheint eine Meldung, dass das System
nun zum Arbeiten zur Verfügung steht (System bitte nicht neu
starten, das wäre nicht im Sinne einer RAM-basierten Installation).
Es kann nun entweder mit einem externen Rechner per Web-Browser auf
ArchivistaVM zugegriffen werden oder durch Eingabe von go (mit
Enter-Taste) ein X-Server gestartet werden.
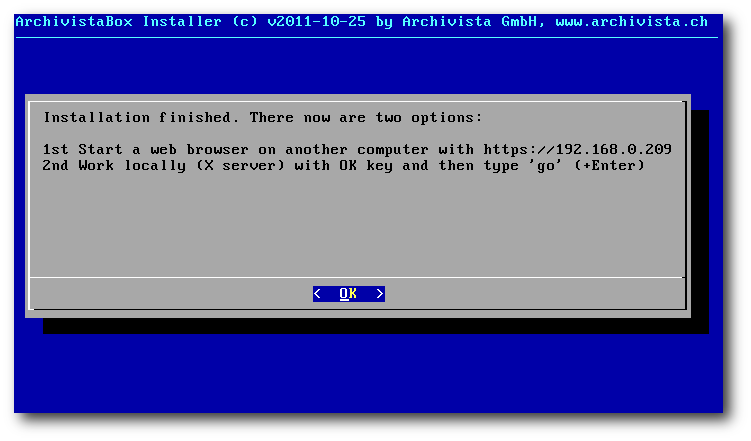
Nach Abschluss der Installation …
Nach etwa 2 Sekunden kann die Tastatur festgelegt werden. Danach
wird umgehend der Browser gestartet; zum Anmelden ist beim Benutzer
root und beim Passwort archivista einzugeben:
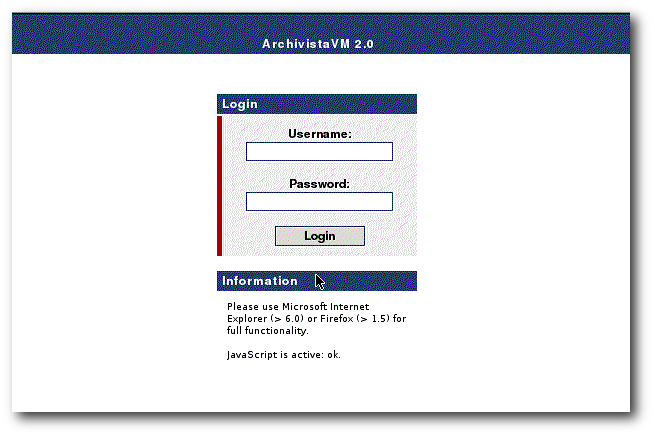
… kann man sich nun im Browser als Benutzer anmelden.
Damit ist die Installation vollständig. Eine Anleitung zum Arbeiten
mit dem KVM-Server alias ArchivistaVM findet man
unter [3].
Start mit interner/externer Festplatte
Wer mit einer vorbestimmten internen/externen Festplatte arbeiten
möchte, kann mit den Parametern ramswap./dev/xxx und
ramdata./dev/yyy sowohl die gewünschte Swap- als auch
Daten-Partition bestimmen. Dazu ein Beispiel:
ram ramswap./dev/sdc2 ramdata./dev/sdd1
Mit den obenstehenden Einstellungen wird die Swap-Partition auf der
dritten Platte und der
zweiten Partition gestartet, die
Daten-Partition erfolgt ab der vierten Festplatte und der ersten
Partition.
Start und Formatieren von Festplatten
Mit der Option ram formathd kann (bei leeren Festplatten)
erzwungen werden, dass eine beim Start gewählte Platte formatiert
und für das Arbeiten mit ArchivistaVM eingerichtet wird.
Hinweis: Mit ram formathd können nur leere Festplatten
eingerichtet werden. Bereits formatierte Platten werden nicht neu
eingerichtet. ram formathd sollte dennoch vorsichtig eingesetzt
werden. Die Entscheidung, ob formatiert wird oder nicht, erfolgt
aufgrund der Partitionstabelle. Sollte diese defekt sein, so wird
die Platte formatiert; auch wenn sich eventuell noch gewisse Daten
restaurieren ließen.
Arbeiten mit Software-Raid
Virtualisierung ist nicht nur eine Frage der Prozessoren oder des
Hauptspeichers, in erster Linie wichtig für die Geschwindigkeit ist
der Zugriff auf die Festplatten.
Mit der Option ram formathd kann bei leeren Festplatten auch ein
Software-Raid eingerichtet, sofern beim Auswählen der Festplatten
mehrere Festplatten ausgewählt werden:
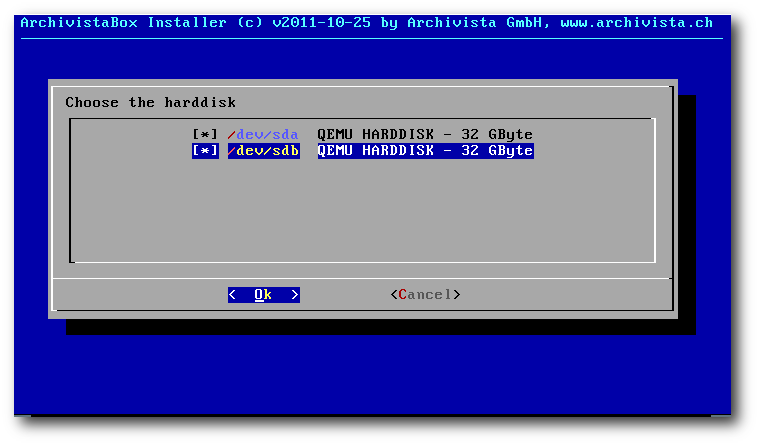
Auswahl der Festplatte für das Software-Raid.
Bei zwei Festplatten wird Raid1 eingerichtet, bei vier, sechs oder
noch mehr Platten erfolgt das Einrichten mit Raid10. Beim Einrichten
eines Raids erfolgt eine Bestätigungsabfrage. Soll Raid0
eingerichtet werden, muss bereits beim Starten ram formathd raid0
eingegeben werden. An dieser Stelle sei ausdrücklich darauf
hingewiesen, dass Raid0 auf eigene Gefahr verwendet wird.
Hinweis: Derzeit können nur von ArchivistaVM eingerichtete
Software-Raids verwendet werden. Allerdings könnte ein Raid auf der
Konsole nachträglich von Hand zugeschaltet werden. Die Treiber aller
gängiger Hardware-Raid-Kontroller sind ebenfalls enthalten, wobei
ArchivistaVM nicht mit sämtlichen Karten getestet werden konnte.
Allenfalls müssten diese von Hand geladen werden, damit die
Partitionen eingebunden werden können.
Alternativ zum direkten Einrichten eines Raid-Verbundes im
RAM-Speicher kann das System zunächst auch komplett auf die
Festplatte gespielt werden. Dies erfordert zwar einen Neustart,
dafür kann ArchivistaVM danach wahlweise mit oder ohne RAM-Modus
eingesetzt werden. Um ArchivistaVM auf der Festplatte einzurichten,
ist beim Starten auf die Eingabe der Option ram zu verzichten.
Selbstverständlich ist beim zweiten Start die Option ram
einzugeben, da ansonsten das System von der Festplatte gestartet wird.
Automatisierung
Der Installer von ArchivistaVM wurde in Perl (objektorientiert)
realisiert. Das Anpassen des Setup-Programmes dürfte für
einigermassen kundige Perl-Programmierer keine grossen
Schwierigkeiten darstellen. Bevor jemand die Datei initrd.img und
das Setup-Programm install.pl selber anzupassen gedenkt, sei auf
die bereits vorhandenen Start-Optionen verwiesen.
Arbeiten mit dem Auto-Modus
ArchivistaVM arbeitet beim Booten mit Syslinux bzw. ab CD-ROM mit
Isolinux. Dazu existieren die beiden Dateien syslinux.cfg sowie
isolinux.cfg direkt im Hauptverzeichnis der ISO-Datei bzw. der
ersten Partition des USB-Sticks.
Einige Informationen zu dieser Datei. Zunächst wird beim Booten zehn
Sekunden gewartet, bis der Start erfolgt. Dies ist etwas
missverständlich, aber abgerechnet wird in Zehntel-Sekunden. Wenn
man eine Minute warten möchte, dann wäre TIMEOUT auf 600 zu
setzen. Mit DEFAULT wird festgelagt, welche Definition ohne
weitere Eingaben gestartet wird. Wenn man z. B. erreichen möchte,
dass immer im RAM-basierten Modus gestartet wird, muss bei Default
ram festgelegt werden.
DEFAULT linux
TIMEOUT 100
PROMPT 1
DISPLAY boot.msg
label linux
kernel vmlinuz
APPEND initrd=initrd.img quiet ramdisk_size=81920
label ram
kernel vmlinuz
APPEND initrd=initrd.img quiet ram ramdisk_size=2097152
label box244
kernel vmlinuz
APPEND initrd=initrd.img quiet ram ramdisk_size=4194304
keyboard.de_CH lang.de auto ip.192.168.2.244
submask.255.255.255.0 gw.192.168.2.1 dns.192.168.2.1 ramdisk
Listing: syslinux.cfg
Spannend ist weiter die Variante box244. Dabei handelt es sich um
ein automatisiertes Startup, welches das System automatisiert
hochfährt. Zentral ist dabei auto. Damit wird erreicht, dass das
Setup-Programm keine Fragen mehr stellt. Und in diesem Modus
ist das System in 30 Sekunden auf einem
USB 2.0-Stick eingerichtet.
Es gibt weitere Parameter, die man direkt im Setup-Programm
install.pl unter der Funktion sub cmdline findet.
Telnet-Zugriff bei Problemen
Am Ende des Setups wird ein SSH-Server gestartet, sodass auf
ArchivistaVM problemlos auf der Konsole zugegriffen werden kann.
Was aber,
wenn das System vor dem Starten des SSH-Servers hängenbleibt?
In einem solchen Falle kann mit ram das Setup-Programm gestartet
werden. Anstatt den Anweisungen danach Folge zu leisten, wird das
Programm abgebrochen. Nun kann auf der Konsole die Netzwerkkarte und
ein telnet-Server eingerichtet werden. Dies geht so:
ifconfig eth0 192.168.0.250
route add default gw 192.168.0.2
telnetd -l /bin/login
Danach kann von einem entfernten Rechner aus mit telnet auf die
Konsole zugegriffen werden, beim Anmelden ist das Passwort
archivista zu verwenden.
Anpassungen an initrd.img
In der Datei initrd.img befindet sich das gesamte Mini-Linux. Beim
Hochfahren des Systems wird zunächst dieses Mini-System
eingerichtet, ehe über den Stick (bzw. CD-ROM) auf system.os
zugegriffen wird. Die Datei system.os enthält ein komplettes
Debian-System bzw. ArchivistaVM. Beim Hochfahren des Servers wird in
einem zweiten Schritt dieses System im RAM eingerichtet, und zwar
äußerst schnell. Pro 1 GByte an Software sind etwa 10 Sekunden Zeit
notwendig. Beide Dateien können beliebig angepasst werden.
initrd.img wird wie folgt ausgepackt:
$ zcat initrd.img | cpio -iv
Dabei wird das gesamte System im aktuellen Verzeichnis ausgepackt.
Es können nun die gewünschten Änderungen am System vorgenommen werden. Für
das Neupacken des Systems in eine Image-Datei ist der folgende Einzeiler zu verwenden:
$ find . | cpio -o -H newc | gzip -c >../isolinux/initrd.img
Anpassungen an system.os
In der Datei system.os befindet sich das gesamte Linux-System von
ArchivistaVM. Dazu ist zu sagen, dass bei ArchivistaVM nicht Debian-
um Debian-Paket installiert wird (dieser Vorgang würde viel zu lange
dauern), sondern dass das gesamte System mit unsquashfs entpackt
wird.
$ unsquashfs -dest /os /tmp/cd/system.os
Das Packen wird mit dem folgenden Befehl erreicht:
$ mksquashfs / /inst/system.os -noappend -e /inst /proc /sys
Fazit
Das System läuft unter einer Bedingung, dass die System-Partition
des RAM-basierten Systems nicht vollläuft, sehr stabil. Ist das RAM
erst mal aufgebraucht, ist die RAM-Platte nämlich unbrauchbar.
Ausgeschlossen werden kann es derzeit nicht. Der hier vorgestellte
KVM-Server kann jedenfalls mit der gleichen Geschwindigkeit von
einem USB-Stick gestartet werden, als wenn das System von der Platte
gestartet würde.
Für einen produktiven Server-Betrieb (KVM-Virtualisierung) sollten
zwei weitere Dinge beachtet werden. Zum einen ECC-RAMs (bei
AMD-Prozessoren laufen die normalen ECC-RAMs problemlos auf jedem
Desktop-Board), zum anderen sollte ein Notstrom-Gerät (USV) zur
Verfügung stehen. Beide Punkte sind aber bei einem Server-Betrieb
ohnehin zu empfehlen.
Neben ArchivistaVM existieren auch ArchivistaDMS
(Dokumenten-Management) sowie ArchivistaDesktop (DMS und
Desktop-Applikationen). Alle drei Systeme enthalten den KVM-Server
für die Virtualisierung, und alle drei ISO-Dateien können auf den
Stick gepackt und wie obenstehend im RAM direkt gestartet werden.
Bei ArchivistaDMS sind mindestens 4 GB RAM erforderlich, beim
ArchivistaDesktop sind ca. 8 GB für ein Arbeiten vorzuhalten. Dafür
können direkt im RAM OpenOffice, Gimp, Scribus, Kile und viele
weiteren Desktop-Applikationen gestartet werden.
Links
[1] http://www.archivista.ch/avvm11.gif
[2] http://www.archivista.ch/avvm-64bit.iso
[3] http://213.160.42.154/d2/help/node71.html
| Autoreninformation |
| Urs Pfister (Webseite)
kaufte sich mit 16 und dem ersten Lohn einen CPC464,
gründete mit 30 die eigene Firma „Archivista”, und ist kurz darauf zu Linux
hinübergeschwenkt. Seit dieser Zeit gilt seine Leidenschaft Open
Source und allem, was dazugehört. Zur Zeit beschäftigt ihn die
Weiterentwicklung der ArchivistaBox.
|
| |
Diesen Artikel kommentieren
Zum Index
von Hans Müller
Das bereits in vorangegangenen Artikeln vorgestellte
OpenAPC-Softwarepaket (siehe „Heimautomatisierung für Hardwarebastler
Teil 1–3“, freiesMagazin 01/2011 [1], 03/2011 [2] und
06/2011 [3])
hat mit der vor kurzem neu veröffentlichten Version 2 – welche auf den
klangvollen Codenamen Aurora Borealis hört – einige umfassend neue
Funktionalitäten erhalten, die einen etwas genaueren Blick auf diese
Veränderungen rechtfertigen. Neben verschiedenen kleinen
Detailverbesserungen, neuen Plug-Ins, die zusätzliche Hardware
unterstützen und einer kleineren Umorganisation des gesamten Paketes
sticht eine Änderung deutlich heraus: mit der Software BeamConstruct
ist jetzt eine Applikation verfügbar, welche auf die Ansteuerung von
Laserscannersystemen [4]
und generell auf Lasermarkieroperationen hin optimiert ist.
Laserscanner?
Der Name indes ist für den unbedarften Benutzer etwas irritierend. Ist
ein Scanner normalerweise ein Gerät, mit dem sich Dinge aus der realen
Welt in digitale Informationen wie z. B. ein Bild oder ein 3D-Modell
umwandeln lassen, so bezeichnet er hier etwas, was eine Oberfläche mit
einem Laser abtastet. Das heißt, am Ende einer Bearbeitung mit einem
solchen Laserscannersystem steht keine Datei und keine Datensammlung,
vielmehr wurde das abgetastete Werkstück selbst verändert. Abhängig
von der gewählten Laserleistung, der Geschwindigkeit des
Bearbeitungsprozesses und des bearbeiteten Materials können dabei die
unterschiedlichsten Aufgaben gelöst und Veränderungen am Material
bewirkt werden. Das beginnt beim Abtragen von Oberflächen (z. B. um ein
Material zu reinigen), geht weiter bei Lasergravierarbeiten (z. B. zum
Beschriften und zur Fertigung von Schildern) sowie beim Laserschweißen
und hört beim Laserschneiden noch lange nicht auf.
Solcherlei mit Lasern bearbeiteten Materialien sind dabei mittlerweile
so weit verbreitet, dass man es manchmal kaum glauben mag, wofür diese
Technik überall verwendet wird. Da ist beispielsweise die
Handytastatur, deren Zahlen mit einem Laser erzeugt wurden, das
Verfallsdatum oder der Gewinnspielcode auf Lebensmittelverpackungen
oder Getränkeflaschen, die matt glänzende, „gebürstete“
Metalloberfläche hochwertiger Geräte oder aber auch die Grillstreifen
auf manchen Fertig-Lebensmitteln.
Aber auch für andere Produktionsprozesse kommen Laser zum Einsatz, so
beispielsweise bei der Herstellung von Solarzellen.
Die dafür eingesetzten Laserscannersysteme besteht dabei aus einem
Scankopf [5],
welcher zwei Spiegel beinhaltet, die den Laser in X- und Y-Richtung
ablenken, dem Laser selbst und einer Controller-Elektronik,
die Scankopf, Laser und die ansteuernde Software miteinander
verbindet.
Optional kann auch noch ein weiteren Element in der Strahlführung des
Lasers vorkommen, welches die Position des Laserfokus verändert. Das
ergibt die Möglichkeit, in Z-Richtung zu positionieren.
Anwendungsgebiete hierfür sind das Rapid
Prototyping [6] oder das
In-Glass-Marking, bei dem dreidimensionale Objekte in einem Glasquader
als solche sichtbar werden.
Linux!
Und genau an dieser Stelle kommt die jetzt neu im OpenAPC-Paket
enthaltene Software BeamConstruct zum Einsatz. War es bisher so, dass
einzelne Hersteller von Scannercontrollern Treiber für Linux anboten
(z. B. Scanlab [7] für alle Karten ab der RTC3) oder
aber generell ein plattformunabhängig zu benutzendes TCP/IP-Interface
in diese implementiert haben (z. B. Raylase [8] in
der SP-ICE2), so sah es bei der Anwendersoftware bisher schlecht aus.
Lasermarkierapplikationen gab es nur für Windows; wer Linux benutzen
wollte, konnte sich nur selbst etwas programmieren. Das ändert sich
mit BeamConstruct jetzt grundlegend, hier ist erstmalig eine
vollständige und umfassende, für Laserscannersysteme optimierte
CAD-Applikation verfügbar, welche auf das
wxWidgets-Toolkit [9] aufsetzt und deswegen für
Windows und Linux zu haben ist. Unter Linux werden dann natürlich nur
die Scannercontroller unterstützt, welche von Haus aus bereits
Linux-Unterstützung bieten, allerdings ist das in dem Fall keine echte
Einschränkung: der Marktführer Scanlab ist bei diesen dabei und wenn
sich die Software entsprechend ihres Potenzials durchsetzt, werden die
anderen Hersteller früher oder später zwangsläufig folgen müssen.
Erste Schritte
Nach dem ersten Start von BeamConstruct zeigt sich dem Benutzer eine
Oberfläche, die dem ebenfalls im OpenAPC-Paket enthaltenen
CNConstruct sehr ähnlich ist. Tatsächlich scheinen beide Applikationen
eine gemeinsame Basis zu nutzen. Das bietet sich auch an, da beide dem
Benutzer ähnliche CAD-Funktionalitäten bieten, welche benötigt werden,
um Prozessdaten zu erzeugen. Die Unterschiede beginnen bei deren
Nutzung: Können die CNConstruct-Daten verwendet werden, um
beispielsweise einen XY-Tisch und eine Fräse anzusteuern, so werden
sie bei BeamConstruct eben zur Ansteuerung eines Scankopfes und eines
Lasers verwendet. Grundsätzlich gilt die folgende Beschreibung aber in
nahezu identischer Weise auch für CNConstruct.
Wer ein Laserscannersystem sein Eigen nennt und dieses mit
BeamConstruct nutzen möchte, sollte die Applikation zuerst
entsprechend der eigenen Hardware konfigurieren. Dazu findet sich im
Menü „Project“ ein Untermenü „Project Settings …“. Dieses öffnet das
Fenster für globale Konfigurationen, im Panel „Hardware“ kann dann
festgelegt werden, welche Geräte von der Software angesteuert werden
können. So ist es zum einen möglich, aus einer Liste verfügbarer
Treiber für Scannercontroller den passenden Typ auszuwählen und diesen
anschließend mit einem Klick auf den Button „Configure“ entsprechend
den eigenen Wünschen anzupassen. Nach dem gleichen Prinzip können bis
zu zwei Motoren ausgewählt und eingestellt werden, mit denen es
möglich ist, zusätzliche Bewegungen auszuführen. Damit lassen sich
später komplexe Abläufe und Steuerungen realisieren wie beispielsweise
das Bearbeiten eines Ringes, welcher dann Schritt für Schritt weiter
gedreht wird, das Bearbeiten übergroßer Flächen, welche per
zusätzlichem XY-Tisch unter dem Scanner weiter bewegt werden und
vieles andere mehr.
An dieser Stelle sollte eine Warnung ausgesprochen werden: Die
Laserbearbeitung ist ein gefährlicher Spaß. Kann ein unbedarfter
Amateur mit einem vergleichsweise harmlosen Werkzeug wie einer
Bohrmaschine beim unsachgemäßen Umgang schon für nennenswerte Schäden
und ernsthafte Verletzungen sorgen, so sind Laser um ein vielfaches
gefährlicher! Bereits Laserleistungen nur wenig oberhalb von 1 mW
(entsprechend Laserklassen ab
3 [10]) können zum
sofortigen Erblinden führen, bei entsprechend höheren Leistungen sind
auch schwere Verbrennungen und Verletzungen möglich. Sicherheit bietet
hier noch nicht einmal die Verwendung von handelsüblichen Laserpointern,
da viele Billigprodukte ebenfalls eine viel zu hohe und hierzulande
damit eigentlich nicht zulässige Leistung abgeben. Beim
Experimentieren mit dieser Technologie ist auf jeden Fall äußerste
Vorsicht geboten, die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen und die
Einrichtung eines umfassenden Laserschutzes sind also unabdingbar!
Auch ist es keine Lösung, sich einfach nur vom Strahlweg des Lasers
fern zu halten. Spätestens wenn dieser auf ein Objekt trifft, wird
dessen Strahlung auch reflektiert. Hat das Objekt dann keine exakt
ebene Oberfläche (wie es nur bei einem Spiegel der Fall wäre) ist die
Reflexionsrichtung und Streuung der Laserstrahlung nicht vorhersehbar.
Und auch wenn das Internet voll von Videos ist, in denen Leute
scheinbar ohne Folgen völlig planlos mit Lasern herumhantieren, so ist
das kein Grund für eine Entwarnung: wenn diese blind sind, sind sie
sicher kaum noch in der Lage ein Video über diesen Zustand zu drehen
und es bei YouTube hochzuladen.
Sind alle Maßnahmen getroffen, welche dafür sorgen, dass der Laser
keinen Schaden anrichten kann, so ist auch die weitere Verwendung von
BeamConstruct sorgenfrei möglich. Wurden alle Einstellungen
vorgenommen, kann das erste Laserprojekt erzeugt werden.
Geometrien und Hierarchien
So finden sich in der Werkzeugleiste am oberen Fensterrand
verschiedene geometrische Grundformen wie z. B. ein Kreis, ein
Rechteck, ein Dreieck aber auch ein Symbol für Text, für Barcodes und
anderes mehr. Wird eines dieser Toolbar-Elemente selektiert, so kann
es anschließend im Zeichenbereich erzeugt werden. Am Beispiel des
Kreises sieht das so aus, dass ein erster kurzer Mausklick in den
Zeichenbereich
(die Maustaste dabei nicht festhalten!) die Position
des Mittelpunktes festlegt. Wird die Maus dann weiter bewegt, zieht
das den Kreis auf – der Radius ergibt sich aus dem Abstand zwischen
der Position des ersten Mausklicks und der aktuellen Position des
Mauszeigers. Ein weiterer Klick mit der linken Maustaste legt diesen
Radius dann fest und beendet den Zeichenvorgang – der Kreis ist jetzt
das erste Element in diesem Beispielprojekt.
Dieser Vorgang hat verschiedene Änderungen innerhalb der Oberfläche
von BeamConstruct bewirkt: so wurde das neue Element „Circle“ rechts
in eine Liste eingetragen, welche eine Übersicht über die vorhandenen
Elemente eines Projektes bietet. Auf der linken Fensterseite wurde ein
Panel „Circle“ zu den dort bereits verfügbaren Tabs hinzugefügt.
Dieses Panel existiert immer nur so lange, wie ein Element innerhalb
des Projektes ausgewählt ist. In diesem lassen sich die Eigenschaften
eines solchen Elementes verändern. Im Falle eines Kreises sind das
beispielsweise der Linientyp (durchgängig, gestückelt, gestrichelt,
Punktmuster, …), dessen Anfangs- und Endwinkel sowie einige Parameter
mehr, welche zum Teil nur für 3-D-Lasersysteme relevant sind, weil sie
den Kreis um die dritte Dimension erweitern.
Eine wirklich interessante Änderung ergibt sich, wenn jetzt in der
Toolbar der Button „Hatch“ (symbolisiert durch mehrere horizontale
Linien in violetter Farbe) betätigt wird. Dieser fügt dem Kreis ein
Füllmuster hinzu. Bereits bekannt: das Panel auf der linken
Bildschirmseite zeigt jetzt die zu diesem Füllmuster gehörenden
Parameter an; hier kann man beispielsweise den Winkel, die Art der
Schraffierung, den Abstand von der umrahmenden Geometrie und anderes
mehr einstellen. Neu ist die Art, wie dieses neue Element in der Liste
auf der rechten Seite angezeigt wird: Jetzt offenbart sich diese als
Baumdarstellung, innerhalb derer die Elemente eines Projektes
hierarchisch angeordnet sind. So sind Hatch-Patterns
(also die
Füllmuster) immer einem grafischen Basiselement untergeordnet, da sie
ja nur auf bereits vorhandene Geometrien aufbauen können.
Dieses Funktionsprinzip geht aber noch weiter, da es neben dem Hatch
auch Elemente zur Nachbearbeitung von Geometrien gibt (in der Toolbar
in roter Farbe dargestellt). Diese verändern die vorhandenen Geometrien
entsprechend ihrer Eigenschaften und ihrer Position unterhalb eines
solchen Basiselements. Soll heißen: eine Liste von Unterelementen wird
immer genau in der vorgegebenen Reihenfolge abgearbeitet.
Das sieht auf den ersten Blick etwas kompliziert aus und kann bei
umfangreichen Kombinationen
von Elementen auch mal zu Verwirrungen
führen, bietet tatsächlich aber deutliche Vorteile. So ist es nicht
nötig, jedes grafische Element mit Unmengen von Parametern zu
überladen, nur um auch noch den letzten geometrischen Kniff aus ihnen
herauszuholen. Vielmehr entsteht mit dieser Methode eine Vielfalt
von Möglichkeiten allein dadurch, dass Elemente frei kombinierbar
sind.
Ein Beispiel ist ein Text, welcher gebogen werden soll, sodass er
beispielsweise kreisförmig um etwas herum gelegt werden kann. Hier ist
nichts weiter als ein Text-Basisobjekt (blaues Symbol „Ab“ in der
Toolbar) sowie das „Curve Distortion“ Nachbearbeitungsobjekt (rotes
Kreissegment-Symbol in der Toolbar) erforderlich. Das erste erzeugt
den Text, das zweite – dem Text-Element als Unterobjekt hinzugefügt –
verbiegt diesen Text.
Variationen und Kombinationen
An diesem Beispiel des radialen Textes lässt sich auch leicht das Prinzip der
Reihenfolge der Unterelemente demonstrieren. Dazu soll in einem
ersten Schritt wieder ein Text-Objekt erzeugt werden. Dieses erwartet
nur einen einzelnen Mausklick im Zeichenbereich, um dessen Position
festzulegen. Dieses Text-Element erhält als erstes Unterelement wieder
ein Hatch-Pattern. Hier wird in den Hatch-Parametern lediglich der
Linienstil von „Continuous“ nach „Connected Lines“ geändert. Ist das
geschehen, sollte wieder das Textelement selbst selektiert werden,
damit im nächsten Schritt das Curve-Nachbearbeitungselement als
weiteres Unterobjekt hinzugefügt werden kann.
Jetzt ist zu sehen, dass das Curve-Element alle Geometrien um diesen
Radius verbiegt, die bis zu diesem Zeitpunkt existieren, es wird also
sowohl der Umriss des Textes als auch sein Füllmuster gebogen. Anders
sieht es jedoch aus, wenn anschließend ein weiteres Hatch-Element
hinzugefügt wird: Dessen Fülllinien werden durch das Curve-Element
nicht beeinflusst, da es in der Reihenfolge der Unterelemente erst
nach diesem
kommt. Die zweiten Hatch-Linien sind gerade; ungeachtet
der zuvor erfolgten Bearbeitung der Geometrien baut dieses Element auf
den an dieser Stelle vorhandenen Daten auf.
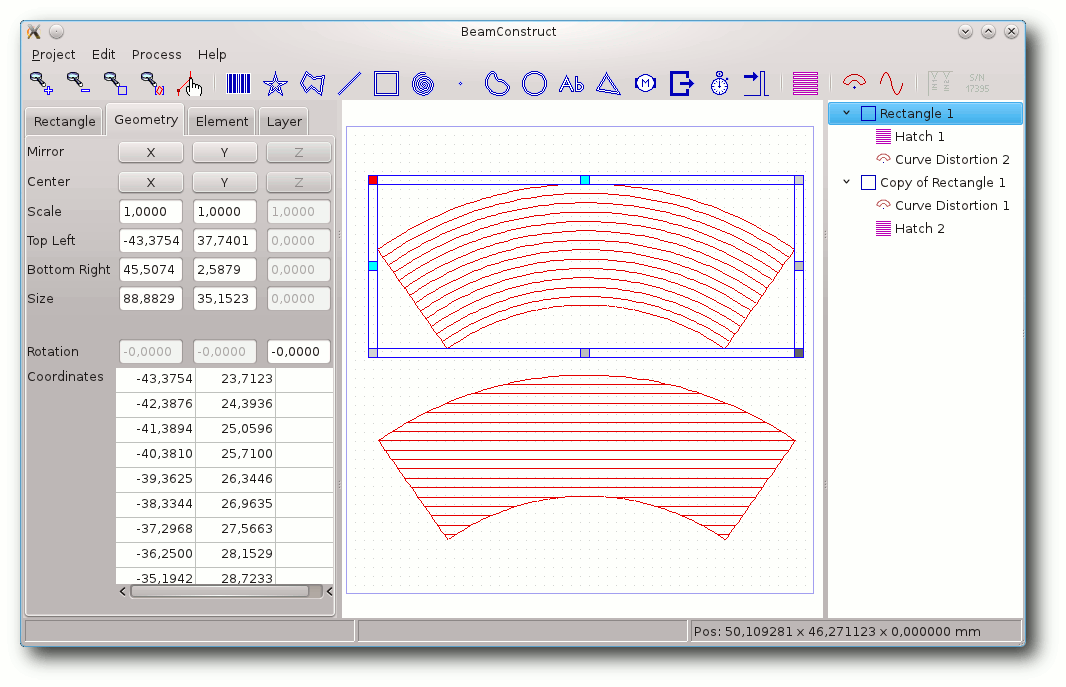
Die Reihenfolge macht's: Gleiche Zusatzelemente mit unterschiedlicher Wirkung, hier im Beispiel eines gehatchten Rechteckes.
Dieses Beispiel zeigt deutlich: allein durch die Kombination
verschiedener Elemente und der Reihenfolge, in der diese gesetzt
werden, sind die unterschiedlichsten Ergebnisse möglich – und das ohne
sich mit komplizierten und verwirrenden Parametern herumschlagen zu
müssen. Neben dieser logischen Struktur bringen zwar fast alle
Elemente noch eigene Parameter mit, diese sind aber recht einfach und
übersichtlich, da sie immer nur auf den Kontext des jeweiligen
Elementes begrenzt sind und keine „Super-Geometrie“ existiert, die
alles können muss.
Die Basiselemente
Diese Elemente – welche in der Applikation selbst als „Primary
Element“ bezeichnet werden –
werden in der Toolbar am oberen
Bildschirm in blauer Farbe dargestellt. Die meisten von ihnen
definieren grundlegende Geometrien, einige Sonderfälle erfüllen aber
Steuerungsaufgaben und manifestieren sich deswegen auch nicht in Form
einer neuen Grafik.
| Basiselemente |
| Dot | ein einzelner Punkt |
| Line | eine Linie |
| Circle | ein Kreis (der sich im 3D-Modus auch in Form einer Spiralfeder in die Tiefe fortsetzen kann) |
| Spiral | eine Spirale (die im 3D-Modus auch in die Tiefe gehen kann) |
| Rectangle | ein Rechteck |
| Triangle | ein Dreieck |
| Star | ein sternförmiges, rotationssymmetrisches Objekt |
| Polygon | ein frei definierbares, offenes oder geschlossenes Vieleck |
| Bezier Curve | eine Abwandlung eines Polygons, bei dem die Eckpunkte nicht direkt miteinander verbunden sind sondern die Stützpunkte einer Bezier-Kurve definieren [11] |
| Text | ein Element zur Textdarstellung; Zeichensatz, Schriftart, Zeichenabstand und vieles mehr sind über die Parameter wählbar |
| Barcode | erzeugt einen Barcode aus vorgegebenen Daten; Typ, Encoding, Darstellung und anderes mehr sind per Parameter wählbar wobei hier alle wichtigen Barcodetypen wie QR, EAN, DataMatrix sowie diverse Pharma-Barcodes unterstützt werden. |
| |
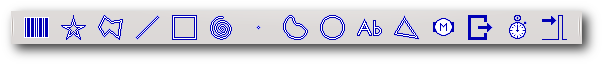
Die Symbole der Basiselemente in der Toolbar.
Basiselemente, welche keine neue Geometrie erzeugen, können
logischerweise auch nicht mit Unterelementen um Geometrien erweitert
bzw. modifiziert werden:
| nicht erweiterbare Basiselemente |
| Motor | fügt zusätzliche Bewegungsinformationen hinzu, welche bei der
Abarbeitung des Projektes den konfigurierten Motor steuert. |
| Laseroutput | viele Scannercontroller besitzen zusätzliche digitale
und analoge Ausgänge; diese können hiermit explizit auf bestimmte
Werte gesetzt werden bzw. es ist möglich, Signale in Form von Pulsen
auszugeben |
| Delay | stoppt die Abarbeitung eines Projektes für eine einstellbare
Zeitspanne |
| External Trigger | wartet mit der Abarbeitung aller nach diesem
Element folgenden Objekte, bis ein externes Triggersignal an der
Scannerkarte festgestellt wurde |
| |
Das Zusatzelement „Hatch“
Innerhalb der Software existiert zwar ein eigener Elementtyp
„Additional Geometry“ (in der Toolbar durch ein violettes Symbol
dargestellt), allerdings gibt es derzeit tatsächlich nur ein Element,
welches zu dieser Gruppe gehört: der eingangs bereits erwähnte
Hatcher. Dieser erlaubt es, bestehende Geometrien zu füllen, um so als
Ergebnis einer Laserbearbeitung nicht nur die Kante eines Objektes zu
sehen, sondern auch dessen Fläche. Hier kommt der Unterschied zwischen
Laserschneiden und -gravieren zum Tragen: würde beim Schneiden die
Kante genügen, um ein Objekt mit einem bestimmten Umriss
auszuschneiden, so ist beim Lasergravieren die Veränderung der Fläche
interessant: Ein beispielsweise auf ein Objekt gelaserter Text soll
auch ausgefüllt werden, so dass nicht nur dessen Umriss als
Veränderung im Material sichtbar wird, sondern auch die Flächen der Buchstaben.

Das einzige Zusatzelement der Werkzeugleiste ist der Hatcher.
Die Nachbearbeitungselemente
Damit die Wirkung dieser Elemente mit dem offiziellen Namen
„Postprocessing Element“ sich auch in sichtbaren und vor allem in den
gewollten Änderungen niederschlägt, ist es meistens erforderlich, für
die vorangegangenen Basis- oder Zusatzelemente in deren Parametern
einen anderen Linientyp als „Continuous“ zu wählen. Die Erklärung
dafür ist denkbar einfach: Nachbearbeitungselemente können nur bereits
existierende Daten verändern, sie fügen keine neuen Geometrien hinzu.
Besteht eine lange Linie dann aber nur aus einem Anfangs- und einem
Endpunkt, so kann das Element auch nur genau diese beiden Punkte
verändern. Und damit lässt sich keine
andere Form als eine Linie erzeugen.
Besteht die Kante eines Objektes jedoch aus vielen kurzen Strichen, so
können die vielen Stützpunkte dieser Linie auch zu einer neuen
Linienform verändert werden.
Sine Distortion – überlagert die Linien einer Geometrie mit einer
Sinuswellenform, sowohl die Richtung der Ausbreitung als auch die Amplitude und Frequenz können dabei festgelegt werden.
Curve Distortion – biegt die übergeordneten Geometrien um einen
Mittelpunkt herum, dessen relative Position, Ausrichtung, Orientierung und Biegeradius festgelegt
werden kann.
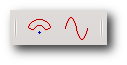
Die Nachbearbeitungselemente verändern bestehende Geometrien.
Die Eingabeelemente
Dieser Elementtyp wird in der Toolbar in grün dargestellt und genießt
eine Sonderrolle. So kann zu jedem Basiselement maximal ein
Eingabeelement existieren. Das aber auch nur dann, wenn das
Basiselement mit den Daten eines solchen Eingabeelements umgehen kann.
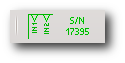
Die Eingabeelemente heben sich in der Toolbar durch grüne Symbole ab.
Das verdeutlicht sich vielleicht an einem Beispiel: Sowohl der Text
als auch das Barcode-Basiselement besitzen in ihrem
Konfigurationspanel Eingabefelder, in denen die Daten hinterlegt
werden können, welche in Form von Text dargestellt oder in den Barcode
hineinverschlüsselt werden können. Genau diese Daten können für diese
beiden Elemente aus eben so einem Eingabeelement kommen. Das klingt
unspektakulär, ist es im Fall des zweiten Eingabeelements aber
definitiv nicht.
OAPC-Input
Wie später noch gezeigt wird, kann ein BeamConstruct-Projekt auch
innerhalb eines OpenAPC-Visualisierungsprojektes verwendet werden.
Dort existiert ein Plug-In, welches mit diesen Projektdaten umgehen
kann und welches zusätzliche Dateneingänge besitzt. Genau einer diese
Dateneingänge wird über die Parameter dieses Eingabeelements auf das
übergeordnete Basiselement umgeleitet. Das heißt nichts anderes, als
dass der Inhalt eines BeamConstruct-Projektes auch außerhalb von
BeamConstruct in einer Maschinensteuerung verändert werden kann, was
sich beispielsweise nutzen lässt, um ständig wechselnde Texte auf
verschiedene Werkstücke zu bringen
Serial/Date/Time
Der Name dieses Elements deutet bereits an, was damit möglich ist: es
lassen sich sowohl Informationen zu Datum und Uhrzeit als auch
Seriennummerndaten generieren, welche dann über den Umweg des
zugehörigen Basisobjektes auf das zu bearbeitende Material aufgebracht
werden können. Dabei sind Kombinationen aus frei wählbarem Text, sich
bei jeder Markieroperation verändernden Zählern, Datums- und
Zeitinformationen in unterschiedlichster Formatierung möglich, welche
es erlauben, die vielfältigsten Anwendungsgebiete abzudecken. So ist
es mittels dieses eher unscheinbaren Elementes möglich, so
unterschiedliche Dinge wie Produktionsdaten, Schichtinformationen,
Verfallsdaten, Seriennummern und vieles andere mehr zu erzeugen – um
die Aktualisierung kümmert sich
die Applikation dabei vor jedem Markierprozess selbst.
Import von Rastergrafiken
Neben der Möglichkeit, eigene Projekte zu erstellen und Vektorgrafiken
diverser Formate zu importieren, können auch sogenannte Pixel- oder
Rastergrafiken importiert werden. Das sind nichts anderes als die
allseits bekannten Bildformate, welche als JPEG, PNG, GIF, BMP oder
anderes mehr daher kommen können.
Abhängig vom verwendeten Lasertyp können damit dann reine
schwarz-weiß-Grafiken (z. B. mit CO2-Lasern) als auch echte
Graustufen-Bilder (z. B. mit YAG-Lasern [12]) auf ein Werkstück
aufgebracht werden.
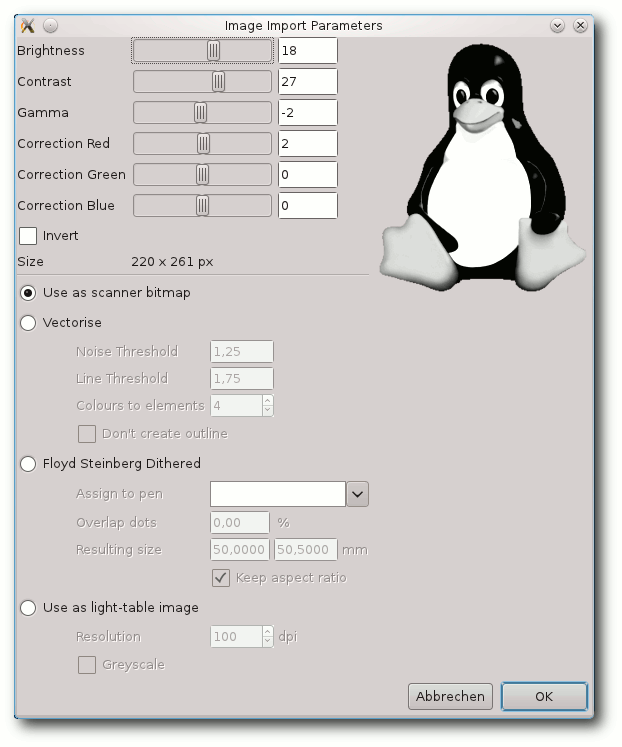
Der Import-Dialog für Raster-Images, Scanner-Bitmaps können auch anschließend noch weiter verändert werden.
Wurde ein entsprechendes Bild über den Menüpunkt „Project -> Import“
geladen, öffnet sich ein Dialog, in dem grundlegende Bildparameter
angepasst werden können. Neben einfachen Möglichkeiten, das Bild noch
ein wenig zu verändern,
kann hier auch festgelegt werden, wie es
innerhalb eines BeamConstruct-Projektes eingesetzt werden soll.
Use as Scannerbitmap
Wird diese Option gewählt, so wird das Bild auf eine Art in das
Projekt importiert, die dafür sorgt, dass es durch den Laser direkt
als echte Bitmap ausgegeben wird. Dabei entscheidet der zuvor für die
Scannerkarte gewählte Lasertyp, ob das Bild in echten Graustufen oder
als Schwarzweißbild wahlweise mit Floyd-Steinberg-Dithering
dargestellt wird
Vectorise
Das Bild wird vektorisiert, d. h. die Pixeldaten werden in
Vektorlinien umgewandelt. Dieser Vorgang ist recht kompliziert und das
Ergebnis hängt auch sehr stark von den gewählten
Vektorisierungsparametern sowie der Qualität des geladenen Bildes ab.
Generell gilt: ein starker Kontrast, eine hohe Auflösung, wenig
Rauschen und erst recht keine Kompressionsartefakte sind wichtige
Voraussetzungen für brauchbare Ergebnisse. Dennoch sollte man auch dann
immer noch eine gewisse Zeit einplanen, um mit den vorhandenen
Parametern zu spielen.
Floyd Steinberg dithered
Auch diese Importmethode wandelt das Bild in Vektordaten um – dieses
Mal allerdings ausschließlich in einzelne
Punkte [13]. Die
Anordnung dieser Punkte ist auf eine bestimmte Größe sowie die
Spot-Größe des Lasers hin optimiert, sodass nach dem
Import keinerlei Skalierfunktionen mehr auf das Ergebnis
angewendet werden sollten.
Use as light-table image
Wird diese Option gewählt, so wird das Bild 1:1, ggf. sogar in Farbe
und ohne Modifikation in das Projekt übernommen. Allerdings kann so
ein Bild nicht über den Laser ausgegeben werden, vielmehr dient es als
Vorlage, um eigene Grafiken zu zeichnen. Der Name „Light-table
image“ – frei übersetzt also „Leuchttischvorlage“ – weist auch auf diesen
Zweck hin; diese Bilder dienen als Vorlage für eigene Geometrien.
Integration in ControlRoom-Projekte
Wurde BeamConstruct entsprechend der vorhandenen Hardware
konfiguriert, so ist es über den Menüpunkt „Process -> Mark“ möglich,
einen Lasermarkierprozess direkt aus der Applikation heraus zu
starten. Dabei werden alle vorhandenen Elemente angesteuert: sowohl der Laser
als auch der Scankopf arbeiten entsprechend der Vektordaten und den
für diese hinterlegten
Laser- und Scannerparameter (wie beispielsweise
Markiergeschwindigkeit, Laserleistung und -frequenz) und die optional
vorhandenen Motoren werden so verfahren, wie es im Projekt definiert
wurde. Des Weiteren wird vor dem Start einer Laserausgabe ein Projekt
auch immer vollständig
aktualisiert: so werden dynamische Elemente wie
Datum/Zeit oder Seriennummern auf den aktuellen Stand gebracht bzw.
weitergezählt.
Da es allerdings die Ausnahme darstellen dürfte, dass die Applikation,
mit der die Prozessdaten erstellt werden, auch die zugehörige Maschine
ansteuert, gibt es auch noch einen weiteren Weg: Die
Prozessvisualisierungs- und -steuerungssoftware „ControlRoom“, welche
ebenfalls Teil des OpenAPC-Paketes ist, kann BeamConstruct-Projekte
laden und abarbeiten. Das geschieht mit Hilfe des zugehörigen Plug-Ins
„BeamConstruct to Control“ welches diese Projekte laden und in
Control-Daten umwandeln kann. Diese werden dann über den Ausgang OUT0
an den Scannercontroller weiter gegeben. Die Ausgänge OUT2 und OUT3
sind optional, sollten aber mit ein oder zwei Motorcontrollern
verbunden sein, sofern die geladenen Projekte diese Motoren erwarten.
Existiert so ein Motor jedoch nicht, so wird ein
BeamConstruct-Projekt, welches diesen erwartet, bis in alle Ewigkeit
auf die Fertigstellung dieser Bewegung warten.
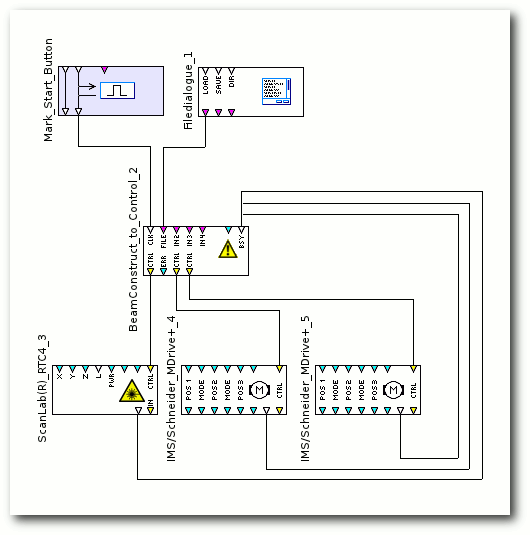
Mögliche Verdrahtung eines ControlRoom-Projektes mit RTC4 und zwei MDrive-Motoren: alle BSY-Ausgänge müssen mit dem BSY-Eingang des Konverter-Plug-Ins verbunden sein.
Daraus ergibt sich auch eine weitere Notwendigkeit: Die BSY
(=busy)-Ausgänge aller an das BeamConstruct-Plug-In angeschlossenen
Komponenten müssen mit dessen BSY-Eingang verbunden werden. Über diese
Leitung wird signalisiert, ob eine Operation – sei es nun ein
Markiervorgang oder eine Motorbewegung – noch läuft oder ob diese
fertiggestellt wurde und zum nächsten Bearbeitungsschritt
übergegangen werden kann.
BeamConstruct versus CNConstruct
Wie eingangs erwähnt sind sich BeamConstruct und CNConstruct
sehr ähnlich. Um genauer zu sein, leistet CNConstruct in weiten Teilen
das Gleiche wie BeamConstruct, allerdings auf einer wesentlich
generischeren Basis. Die dort erstellten Geometrien sind nicht bereits
für eine bestimmte Art der Bearbeitung optimiert, vielmehr bleibt es
hier völlig offen, wie der eigentliche Prozess aussieht.
Anders ist das bei BeamConstruct: hier sind verschiedene zusätzliche
Funktionalitäten enthalten, welche nur für die Laserbearbeitung
sinnvoll sind; auch sind die Penparameter bereits auf das
Ausgabemedium „Laser“ abgestimmt. Ein weiterer deutlicher Unterschied:
CNConstruct erlaubt nur eine Simulation des Prozesses, BeamConstruct
kann vorhandene Hardware auch selbst ansteuern und so einen Prozess
ablaufen lassen.
Sieht man hiervon einmal ab, sind sich beide aber durchaus ähnlich. So
kann man die hier beschriebene Vorgehensweise für das Erstellen von Projekten, Hierarchien
und Kombinationsmöglichkeiten von Elementen 1:1 für CNConstruct
übernehmen – das grundlegende Bedienkonzept ist bei beiden
Applikationen das Gleiche.
Licht versus Schatten
Zu jeder Programmvorstellung gehört immer auch eine gehörige Portion
Kritik der Mängel (die jede Software hat), der Softwarefehler und
sonstigen Unzulänglichkeiten. So etwas gibt es auch bei BeamConstruct;
ab und zu findet sich mal ein unerklärlicher Absturz (weswegen es sich
empfiehlt, ein Projekt öfter mal zu speichern), hin und wieder tut die
Applikation nicht wirklich das, was man erwartet.
Allerdings fällt es schwer, das jetzt als echten Kritikpunkt
hervorzuheben, da die hier getestete Version aus dem OpenAPC 2.0 Paket
noch als Alpha-Version gekennzeichnet ist. Damit werden eigentlich
Softwarestände gekennzeichnet, welche sich in der Regel irgendwo im
Zustand „experimentell“ befinden. Das gilt in diesem Fall ganz klar
nicht; mit der Software lässt sich arbeiten und sie ist definitiv
benutzbar. Es bleibt also abzuwarten, welche Verbesserungen sich bis zur ersten stabilen Release noch ergeben.
Auch wenn aus diesem Grund ebenso mit Lob gespart werden soll, eins
bleibt hervorzuheben: dass es mit BeamConstruct jetzt auch eine
Lasermarkiersoftware für Linux gibt, bedeutet für die gesamte
Laserbranche ein echtes Novum – und setzt für die Zukunft hoffentlich
Maßstäbe!
Links
[1] http://www.freiesmagazin.de/freiesMagazin-2011-01
[2] http://www.freiesmagazin.de/freiesMagazin-2011-03
[3] http://www.freiesmagazin.de/freiesMagazin-2011-06
[4] http://de.wikipedia.org/wiki/Laserscanning#Materialbearbeitung_und_Fertigung
[5] http://de.wikipedia.org/wiki/Laserscanning#Scankopf
[6] http://de.wikipedia.org/wiki/Rapid_Prototyping
[7] http://www.scanlab.de
[8] http://www.raylase.com/
[9] http://www.wxwidgets.org/
[10] http://de.wikipedia.org/wiki/Laser#Laser-Klassen
[11] http://de.wikipedia.org/wiki/Bézierkurve
[12] http://de.wikipedia.org/wiki/Nd:YAG-Laser
[13] http://de.wikipedia.org/wiki/Floyd-Steinberg-Algorithmus
| Autoreninformation |
| Hans Müller
ist als Elektroniker beim Thema industrielle
Automatisierung mehr der Hardwareimplementierung zugeneigt als dem
Softwarepart und hat auch schon diverse Geräte in der
privaten Wohnung verkabelt.
|
| |
Diesen Artikel kommentieren
Zum Index
von Sujeevan Vijayakumaran
Google Code-In [1]
ist ein Wettbewerb, der von Google veranstaltet wird und sich
ausschließlich an Schüler richtet. Die Teilnehmer tragen bei diesem
Wettbewerb zu vielen verschiedenen Open-Source-Projekten bei und können
zahlreiche kleinere Aufgaben erledigen. Teilnahmeberechtigt sind alle
Jugendlichen zwischen 13 und 18 Jahren, die eine Schule besuchen.
Insgesamt beteiligen sich 18 Projekte bei dem Wettbewerb. Darunter
sind neben den beiden großen Desktop-Umgebungen GNOME und KDE auch
openSUSE und FreeBSD vertreten.
Aufgaben
Insgesamt gibt es für die Teilnehmer acht verschiedene Typen von
Aufgaben zu erfüllen. In die Aufgabengruppen fallen nicht nur
Programmieraufgaben, sondern auch Dokumentation, Qualitätssicherung
und das allgemeine Lösen von Problemen. Des Weiteren können die
Teilnehmer an Aufgaben arbeiten, die sich um Marketing und
Community-Management drehen. Auch können Hilfestellungen bei der
Benutzung eines bestimmten Projektes gegeben oder Problemstellungen
zur graphischen Oberfläche bearbeitet sowie Übersetzungen
vorgenommen werden.
Jede Aufgabe hat einen bestimmten Status. Bevor man die Arbeit
beginnen kann, muss man eine offene Aufgabe finden und diese dann
für sich beantragen. So ändert sich der Aufgabenstatus von „open“ zu
„claim requested“, bis ein Mentor des Projektes die Aufgabe zur
Bearbeitung freigibt. Dann ändert sich der Status zu „claimed“ und
der Schüler kann mit der Arbeit beginnen. Für die Bearbeitung wird
eine bestimmte Zeit vorgegeben, in der man seine erste Lösung
abgeben muss. Der Mentor des dazugehörigen Projekts überprüft die
Aufgabenlösung und kann eine weitere Bearbeitungszeit mit
Verbesserungsvorschlägen vergeben, sodass Korrekturen an der Lösung
vorgenommen werden können. Der Mentor kann die Aufgabe auch wieder
zur Bearbeitung freigeben, wenn keine Lösung eingegangen oder etwas
völlig Irrelevantes angekommen ist. Bei vollständiger Lösung
markiert der Mentor die Aufgabe als vollendet.
Nach der ersten
Vervollständigung einer Aufgabe seitens des Teilnehmers muss dieser sich
mit vollen persönlichen Daten registrieren, sodass danach die
Aufgabe als von ihm erledigt markiert werden kann. Danach kann er
eine neue Aufgabe beantragen. Es kann immer nur eine Aufgabe zur
selben Zeit beantragt werden.
Jede Aufgabe hat einen Schwierigkeitsgrad, mit dem auch gleichzeitig
Punkte vergeben werden. Diese werden in die Grade „leicht“,
„mittel“ und „schwer“ einsortiert. Je schwieriger oder aufwendiger
die Aufgabe, desto mehr Punkte gibt es. Für schwierige Aufgaben gibt
es vier Punkte, für mittlere zwei Punkte, und für leichte einen
Punkt. Aus den erzielten Punkten wird dann ein Ranking erstellt.
Preise
Jeder Teilnehmer, der mindestens eine Aufgabe vollständig abgibt,
bekommt einen Preis. Sofern er weniger als drei Aufgaben erledigt,
bekommt er ein Google Code-In-T-Shirt und eine Urkunde für die
erfolgreiche Teilnahme postalisch überreicht. Für jede dritte
erledigte Aufgabe winken 100 US-Dollar als Preisgeld. Maximal werden
500 US-Dollar Preisgeld pro Teilnehmer ausgezahlt. Die Anzahl der
Aufgaben ist hingegen nicht limitiert, sodass jeder Teilnehmer so
viele Aufgaben erledigen kann, wie er möchte. Neben dem T-Shirt und
dem Preisgeld werden außerdem zehn „Grand Prize Winners“ gekürt.
Diese Gewinner werden anhand des Rankings der erreichten
Gesamtpunktzahl ermittelt. Die „Grand Prize Winners“ erhalten eine
fünftägige Reise zu Googles Hauptzentrale in Mountain View in den
USA und dürfen ein Elternteil als Begleitperson mitbringen. Im
letzten Jahr wurden 14 „Grand Prize Winners“ gekürt.
Verlauf
Der Wettbewerb ist in verschiedene Zeitabschnitte unterteilt. Er
startete bereits am 21. November 2011. Ab diesem Tag können die
Schüler die ersten Aufgaben für die teilnehmenden Projekte
beantragen, die die Open-Source-Projekte zuvor zur Bearbeitung
freigegeben haben. Die erste Runde endet am 16. Dezember 2011, dann
geben die Projekte erneut Aufgaben zur Bearbeitung frei. Google
Code-In läuft am 16. Januar 2012 aus. Im Februar werden dann die
„Grand Prize Winner“ in einem Blogpost genannt. Die Teilnehmer
müssen nach Ende des Wettbewerbs ein Dokument von einem Elternteil
beziehungsweise Erziehungsberechtigten unterschreiben lassen und in
einem Formular hochladen, damit sie die Preise erhalten können.
Fazit
Google Code-In bietet für Schüler durch die vielfältigen
Aufgabentypen einen sehr guten Einblick in Open-Source-Projekte.
Durch verschiedene Schwierigkeitsgrade und eine breite Anzahl an
Aufgaben können sie sich hervorragend einbringen. Gute
Englischkenntnisse sind allerdings Voraussetzung, sowohl zum
Verständnis der Aufgaben als auch zur Kommunikation mit den
Mentoren. Für die deutschsprachigen Teilnehmer gibt es nur wenige
Übersetzungsaufgaben zu erledigen, da häufig osteuropäische oder
Übersetzungen für andere Sprachen gebraucht werden. Die
Programmieraufgaben lassen sich in vielen Teilen nur mit sehr guten
Kenntnissen der Sprachen lösen. Vor allem Python und C++ sind
gefordert, da sie häufig Anwendung in Open-Source-Projekten finden.
Schwierig ist es, diese Aufgaben neben dem Schulalltag zu erledigen,
da der Zeitraum zur Erledigung einer Aufgabe teilweise sehr knapp
bemessen ist.
Nichtsdestotrotz bietet dieser Wettbewerb einen guten Einblick und
Einstieg in Open-Source-Projekte für interessierte Schüler, die mit
einem guten Preisgeld auch noch ihr Taschengeld aufbessern können.
Links
[1] http://www.google-melange.com/gci/homepage/google/gci2011
| Autoreninformation |
| Sujeevan Vijayakumaran (Webseite)
hat im letzten Jahr am Google Code-In Wettbewerb teilgenommen.
|
| |
Diesen Artikel kommentieren
Zum Index
von Michael Niedermair
Das Buch aus der Reihe „kurz & gut“ stellt eine Referenz für das Office-Programm LibreOffice
dar, welches aus der Zusammenarbeit von Entwicklern und der
Community der kürzlich gegründeten „The Document Foundation“ entstanden
ist. Dabei werden die Programme Writer, Calc, Base, Draw und Impress behandelt.
Was steht drin?
Das Buch hat eine kurze Einführung und bespricht dann in sechs Kapiteln die
obigen Programme. Abgeschlossen wird die Referenz durch einen Menüindex und ein
Stichwortverzeichnis.
Die Bereiche sind im Wesentlichen alle gleich aufgebaut. Dabei werden die
jeweils zu dem Programm gehörenden Symbolleisten und Menüs erläutert und die
wichtigsten Tastenkürzel dargestellt. Dann erfolgt ein Verweis, auf welcher
Seite die Beschreibung zu den Tastenkürzeln folgt.
Der erste
Abschnitt (89 Seiten) befasst sich mit der Textverarbeitung Writer. Danach
erfolgt die Beschreibung des Formeleditors (10 Seiten). Im dritten Bereich (38
Seiten) geht es um die Tabellenkalkulation mit Calc. Im Anschluss (32 Seiten)
folgt das Datenbankfrontend Base. Standardmäßig wird hier HSQLDB verwendet,
es kann aber auch jede andere Datenbank (DBMS-System) verwendet werden, wenn
ein entsprechender Treiber vorhanden ist. Im fünften Bereich (23 Seiten) geht
es um Vektorzeichnungen mit Draw. Der letzte Abschnitt (23 Seiten) beschäftigt
sich mit der Präsentationserstellung mit Impress.
Zum Schluss folgt ein Menüindex (14 Seiten), der nach Programmen gruppiert die
einzelnen Menübefehle/-einträge enthält und auf die entsprechende Seite
verweist. Danach kommt das normale Stichwortverzeichnis mit 17 Seiten.
Wie liest es sich?
Das Buch ist eine reine Referenz und zeigt kurz und bündig die notwendigsten
Sachen auf, um mit der Office-Suite LibreOffice zu arbeiten. Durch die am
Anfang jedes Bereiches dargestellte Funktionsübersicht mit Verweis auf die
einzelnen Seiten findet man schnell den entsprechenden Bereich.
Passende Screenshots zeigen einem schnell, wo man Einstellungen vornehmen
bzw. wie man eine Funktion aufrufen kann.
Kritik
Das Buch ist als Referenz ausgelegt und für diesen Zweck sehr gut
geeignet. Durch die Übersicht am Anfang jeden Bereiches, dem Menüindex am
Ende und das Stichwortverzeichnis findet man sehr schnell die gesuchte
Information. Für das normale Arbeiten und etwas Erfahrung reicht die Referenz
sicher aus. Steigt man in die verschiedenen Bereiche tiefer ein, ist
Zusatzliteratur mit ausführlicherer Beschreibung notwendig.
Das Buch umfasst
268 Seiten und besitzt bei einem Preis von 12,90 Euro ein sehr gutes
Preis-Leistungs-Verhältnis, was man nicht bei allen
„kurz & gut“-Büchern
sagen kann. Einziger Kritikpunkt zum Inhalt ist der Bereich zum Formeleditor.
Hier hätte ich mir etwas mehr gewünscht, z. B. zu aufwändigeren Formeln.
Bedenken habe ich beim Softcover hinsichtlich der dünnen Rückenbindung,
da diese nach einer gewissen Zeit ihre Haltefunktion
verlieren könnte und Einzelblätter die Folge wären.
Der Index ist gut aufgebaut und die Einträge haben meist nur eine Seitenzahl,
was dazu beträgt, dass man schnell die entsprechende Stelle findet.
| Buchinformationen |
| Titel | LibreOffice – kurz & gut (1. Auflage) |
| Autor | Karsten Günther |
| Verlag | O'Reilly, August 2011 |
| Umfang | 268 Seiten |
| ISBN | 978-3-86899-118-5 |
| Preis | 12,90 Euro |
| |
| Autoreninformation |
| Michael Niedermair (Webseite)
ist Lehrer an der Münchener IT-Schule
und unterrichtet hauptsächlich Programmierung,
Datenbanken und IT-Technik. Nebenbei schreibt er viel
mit LibreOffice und LaTeX. |
| |
Diesen Artikel kommentieren
Zum Index
von Jochen Schnelle
CouchDB [1] gehört zu den bekannteren
Vertretern der Generation der NoSQL-Datenbanken. Was wohl auch daran
liegt, dass sich CouchDB relativ leicht in eigene Projekte
integrieren lässt, eine einfache API hat und das einige große
Projekte wie z. B. Ubuntu One [2] auf CouchDB
als Speicherlösung setzen. Jedenfalls ist die Datenbank populär
genug, dass sich der Verlag Galileo Computing dazu entschieden hat,
ihr ein eigenes Buch zu widmen.
Redaktioneller Hinweis: Wir danken dem Verlag Galileo Computing für
die Bereitstellung eines Rezensionsexemplares.
Nun gibt es bereits einige Bücher zu CouchDB, unter anderem die auch
schon in freiesMagazin besprochenen „Beginning CouchDB“ oder
„CouchDB kurz & gut“ (Rezensionen siehe freiesMagazin 08/2010
[3]). Allerdings
zielt das vorliegende Buch in eine etwas andere Richtung, wie der
Untertitel andeutet. Dieser lautet nämlich: „Das Praxisbuch für
Entwickler und Administratoren“. Geschrieben ist das Buch von
Andreas Wenk und Till Klamäckel, beide Softwareentwickler, welche
nach eigenen Angaben CouchDB schon länger selbst produktiv nutzen.
Inhaltliches
Das rund 300-seitige Buch ist in insgesamt sechs Kapitel unterteilt.
Das erste Kapitel namens „Einführung“ widmet sich der Historie von
CouchDB, stellt dessen Entwickler kurz vor und führt allgemein in
Datenbanken und speziell NoSQL-Datenbanken ein. Im zweiten Kapitel,
welches gleichzeitig mit 85 Seiten das längste ist, werden alle
Grundlagen und Funktionen von CouchDB erklärt. Dies beginnt mit dem
einfachen Anlegen von Datenbanken und Dokumenten, dem Erstellen von
Views, List- und Show-Funktionen und behandelt auch etwas
fortgeschrittenere Themen wie Replikation, Authentifizierung und
URL-Rewriting. Im dritten und vierten Kapitel wird eine Applikation,
genauer gesagt ein einfaches Kassenbuch, entwickelt, welche alleine
mit CouchDB und Javascript realisiert wird. Der Unterschied zwischen
den Kapiteln ist der, dass Kapitel drei auf „nacktes“ Javascript und
HTML setzt, während in Kapitel vier CouchApp [4]
zum Einsatz kommt, was stark auf
jQuery und weitere Javascript-Bibliotheken setzt. Im fünften Kapitel
wird die Installation und detaillierte Konfiguration erläutert.
Ebenso sind Hinweise und Tipps zur Skalierung von CouchDB zu finden.
Das sechste und letzte Kapitel beschreibt die Anbindung von CouchDB
an verschiedene Programmiersprachen wie PHP, Ruby, Python und
Javascript. Den Abschluss des Kapitels bildet ein kurzer Abschnitt
zu Ubuntu One und dessen Nutzung der Datenbank.
Qualitatives
Beim Lesen des Buchs wird schnell klar: die Autoren haben ein sehr
umfassendes Wissen, was sie auf jeder Seite an den Leser bringen
wollen. Dieses beschränkt sich dabei nicht nur allein auf CouchDB.
So werden im ersten Kapitel auch einige Grundlage von Datenbanken wie
das ACID-Prinzip, der B-Tree-Index oder das CAP-Theorem behandelt.
Alles ist aber praxisnah und kompakt gehalten, es gibt keine
Ausschweifungen in die Theorie. Die Praxisnähe ist auch in den
anderen Kapiteln wiederzufinden. Immer wieder gibt es Tipps und
Tricks für den Alltagsgebrauch und es wird auch vor möglichen
Stolpersteinen und Unzulänglichkeiten gewarnt.
Gut ist ebenfalls, dass das Buch auch die zur Zeit aktuellste
Version von CouchDB behandelt, nämlich 1.1. An diversen Stellen im
Buch finden sich weiterhin Hinweise, seit welcher Version eine
bestimmte Funktion zur Verfügung steht, so dass auch Anwender
älterer Versionen der Datenbank auf ihre Kosten kommen.
Strukturelles
Bei der Vielzahl der Informationen ist es naturgemäß nicht einfach,
diese richtig und in der richtigen Reihenfolge dem Leser näher
zu bringen. Das Buch wirkt dadurch an einigen Stellen etwas
unstrukturiert, da auf Themen vorgegriffen wird, die erst später
abgehandelt werden. Besonders auffällig ist dies z. B. in Kapitel 2.
Im Abschnitt 2.2 wird auf die grafische Oberfläche von CouchDB
namens Futon eingegangen. Hier wird unter anderem auch erklärt, wie
man Views via Futon anlegt. Nur was ein View überhaupt ist, wird
erst
später im Abschnitt 2.5. erklärt. Das Buch wird dadurch zwar an
keiner Stelle unverständlich oder konfus, nur wer noch nie mit
CouchDB gearbeitet hat, der kann stellenweise Schwierigkeiten haben,
dem Inhalt zu folgen. Wer hingegen ein wenig Wissen rund um die
Datenbank hat, der sollte keine Probleme bekommen.
Fazit
Der Untertitel des Buchs ist Programm: „Das Praxisbuch für
Entwickler und Administratoren“. Aktive Anwender – und solche die es
werden wollen – finden in dem Buch Unmengen von Informationen, Tipps
und Tricks zu allen Bereichen von CouchDB. Nach dem Lesen des Buchs
sollten hier kaum noch Fragen offen sein. Für Neueinsteiger ist die
Informationsdichte und -geschwindigkeit allerdings eher zu hoch.
Hier ist das eingangs erwähnte (englischsprachige) Buch „Beginning
CouchDB“ wohl besser geeignet.
Wer sich näher mit CouchDB beschäftigen oder die Datenbank selber
aktiv einsetzen möchte, dem kann das Buch aber durchaus empfohlen
werden.
Quizfrage
Und weil es ja schade wäre, wenn das Buch bei Jochen Schnelle im
Bücherregal verstaubt, verlosen wir „CouchDB“ an die erste Person,
die uns folgende Frage beantworten kann:
„CouchDB wird über HTTP-Methoden wie GET, PUT etc. gemäß RFC 2616
angesprochen. Zusätzlich zu den dort definierten Methoden
implementiert die Datenbank noch eine weitere Methode außerhalb des
Standards. Wie heißt diese?”
Antworten können wie immer über den Kommentarlink am Ende des
Artikels oder per E-Mail an  eingesendet
werden.
eingesendet
werden.
| Buchinformationen |
| Titel | CouchDB |
| Autor | Andreas Wenk und Till Klamäckel |
| Verlag | Galileo Computing |
| Umfang | 304 Seiten |
| ISBN | 978-3-8362-1670-8 |
| Preis | 34,90 € |
| |
Links
[1] http://couchdb.apache.org/
[2] http://one.ubuntu.com
[3] http://www.freiesmagazin.de/freiesMagazin-2010-08
[4] http://couchapp.org/page/index
| Autoreninformation |
| Jochen Schnelle (Webseite)
nutzt selber CouchDB seit ca. 1,5 Jahren für
verschiedene Projekte. Im Buch hat er trotzdem noch einige
interessante Informationen gefunden.
|
| |
Diesen Artikel kommentieren
Zum Index
A
Android
| Rezension: Android 3 – Apps entwickeln mit dem Android SDK | 11/2011 |
| Rezension: Einführung in die Android-Entwicklung | 10/2011 |
| |
B
Bildbearbeitung
| GIMP-Tutorial: Farben durch Graustufen hervorheben (Colorkey) | 03/2011 |
| |
Browser
| Gesunde Datenkekse backen – Firefox mit Erweiterungen absichern | 03/2011 |
| Rezension: Durchstarten mit HTML5 | 04/2011 |
| |
Buch
| Rezension: Android 3 – Apps entwickeln mit dem Android SDK | 11/2011 |
| Rezension: Bash – kurz & gut | 02/2011 |
| Rezension: Coders At Work | 03/2011 |
| Rezension: Coding for Fun mit Python | 05/2011 |
| Rezension: Computergeschichte(n) – nicht nur für Geeks | 06/2011 |
| Rezension: CouchDB | 12/2011 |
| Rezension: Durchstarten mit HTML5 | 04/2011 |
| Rezension: Einführung in die Android-Entwicklung | 10/2011 |
| Rezension: Essential SQLAlchemy | 04/2011 |
| Rezension: LPI 301 | 08/2011 |
| Rezension: LibreOffice – kurz & gut | 12/2011 |
| Rezension: NetBeans Platform 7 – Das umfassende Handbuch | 11/2011 |
| Rezension: Praxiskurs Unix-Shell | 06/2011 |
| Rezension: Python von Kopf bis Fuß | 09/2011 |
| |
Buch (Fortsetzung)
| Rezension: Root-Server einrichten und absichern | 02/2011 |
| Rezension: Seven Languages in Seven Weeks | 07/2011 |
| Rezension: The Python Standard Library by Example | 09/2011 |
| Rezension: Vi and Vim Editors | 07/2011 |
| Rezension: VirtualBox – Installation, Anwendung, Praxis | 10/2011 |
| |
C
CRM
| Zehn Jahre Warenwirtschaft C.U.O.N. | 05/2011 |
| |
Community
| Bericht von der Ubucon 2011 | 11/2011 |
| Dritter freiesMagazin-Programmierwettbewerb beendet | 02/2011 |
| Google Code-In | 12/2011 |
| Vierter freiesMagazin-Programmierwettbewerb | 10/2011 |
| |
D
Datenbanken
| Cassandra – Die Datenbank hinter Facebook | 09/2011 |
| Rezension: Essential SQLAlchemy | 04/2011 |
| |
Datenverwaltung
| Einblicke in Drupal | 06/2011 |
| Zehn Jahre Warenwirtschaft C.U.O.N. | 05/2011 |
| |
Debian
| ArchivistaVM – Server-Virtualisierung für die Hosentasche mit USB-Stick | 12/2011 |
| Debian GNU/Linux 6.0 „Squeeze“ | 04/2011 |
| |
Desktop
| Compositing nach X11 – KDE Plasma auf dem Weg nach Wayland | 08/2011 |
| |
Desktop (Fortsetzung)
Distribution
| ArchivistaVM – Server-Virtualisierung für die Hosentasche mit USB-Stick | 12/2011 |
| Erweitertes RC-System von OpenBSD | 11/2011 |
| Fedora 15 | 07/2011 |
| Pardus 2011.2 | 12/2011 |
| Ubuntu 11.04 – Vorstellung des Natty Narwhal | 06/2011 |
| Ubuntu und Kubuntu 11.10 | 11/2011 |
| |
E
E-Mail
| „I don't like spam“, oder wie man einen Mailserver testet | 09/2011 |
| |
F
Fedora
Fenstermanager
| i3 – ein Tiling Fenstermanager | 09/2011 |
| |
Freie Projekte
| Plattformen für die Entwicklung und Verwaltung von Open-Source-Projekten | 09/2011 |
| |
G
GNOME
| GNOME 3.0: Bruch mit Paradigmen | 06/2011 |
| |
Google
| Google Code-In | 12/2011 |
| Plattformen für die Entwicklung und Verwaltung von Open-Source-Projekten | 09/2011 |
| Rezension: Android 3 – Apps entwickeln mit dem Android SDK | 11/2011 |
| Rezension: Einführung in die Android-Entwicklung | 10/2011 |
| |
Grafik
| Dateigrößenoptimierung von Bildern | 05/2011 |
| Der Grafikeditor Ipe | 11/2010 |
| Pixelfreie Screenshots | 11/2011 |
| Sketch – 3-D-Grafikcode für LaTeX erstellen | 02/2011 |
| Über Benchmarks | 07/2011 |
| |
H
HTML
| PHP-Programmierung – Teil 1: HTML | 10/2011 |
| PHP-Programmierung – Teil 2: Kontrollstrukturen | 11/2011 |
| PHP-Programmierung – Teil 3: Arrays, Sessions, Sicherheit | 12/2011 |
| Python-Frameworks für HTML-Formulare | 12/2011 |
| Rezension: Canvas – kurz & gut | 11/2011 |
| |
Hardware
| BeamConstruct – Linux in der Laserindustrie | 12/2011 |
| Heimautomatisierung für Hardwarebastler | 01/2011 |
| Heimautomatisierung für Hardwarebastler (Teil 2) | 03/2011 |
| Heimautomatisierung für Hardwarebastler (Teil 3) | 06/2011 |
| Linux als ISDN-Telefon | 01/2011 |
| |
I
Instant-Messaging
| UnrealIRC – gestern „Flurfunk“, heute „Chat“ | 06/2011 |
| |
Internet
| Aptana Studio – Eine leistungsfähige Web-Entwicklungsumgebung | 10/2011 |
| Bottle – Ein WSGI-Microframework für Python | 02/2011 |
| Einblicke in Drupal | 06/2011 |
| Freie Webanalytik mit Piwik | 08/2011 |
| Linux als ISDN-Telefon | 01/2011 |
| PHP-Programmierung – Teil 1: HTML | 10/2011 |
| PHP-Programmierung – Teil 2: Kontrollstrukturen | 11/2011 |
| PHP-Programmierung – Teil 3: Arrays, Sessions, Sicherheit | 12/2011 |
| Plattformen für die Entwicklung und Verwaltung von Open-Source-Projekten | 09/2011 |
| Python-Frameworks für HTML-Formulare | 12/2011 |
| Rezension: Durchstarten mit HTML5 | 04/2011 |
| „I don't like spam“, oder wie man einen Mailserver testet | 09/2011 |
| |
J
Java
| Rezension: Android 3 – Apps entwickeln mit dem Android SDK | 11/2011 |
| Rezension: Einführung in die Android-Entwicklung | 10/2011 |
| Rezension: NetBeans Platform 7 – Das umfassende Handbuch | 11/2011 |
| |
K
KDE
| Compositing nach X11 – KDE Plasma auf dem Weg nach Wayland | 08/2011 |
| Plasma erobert die Welt | 01/2011 |
| Trinity – Desktop ohne Zukunft | 09/2011 |
| |
Kernel
| Der April im Kernelrückblick | 05/2011 |
| Der August im Kernelrückblick | 09/2011 |
| Der Dezember im Kernelrückblick | 01/2011 |
| Der Februar im Kernelrückblick | 03/2011 |
| Der Januar im Kernelrückblick | 02/2011 |
| Der Juli im Kernelrückblick | 08/2011 |
| Der Juni im Kernelrückblick | 07/2011 |
| Der Mai im Kernelrückblick | 06/2011 |
| Der März im Kernelrückblick | 04/2011 |
| Der November im Kernelrückblick | 12/2011 |
| Der Oktober im Kernelrückblick | 11/2011 |
| Der September im Kernelrückblick | 10/2011 |
| Kernel-Crash-Analyse unter Linux | 02/2011 |
| Was Natty antreibt: Ein Blick auf den Kernel von Ubuntu 11.04 | 05/2011 |
| |
Kommerzielle Software
| Kurzreview: Humble Indie Bundle 3 | 08/2011 |
| Kurzreview: Humble Voxatron Debut | 11/2011 |
| SpaceChem – Atome im Weltall | 04/2011 |
| |
Konsole
| Datenströme, Dateideskriptoren und Interprozesskommunikation | 03/2011 |
| Rezension: Bash – kurz & gut | 02/2011 |
| Rezension: Praxiskurs Unix-Shell | 06/2011 |
| Rezension: Vi and Vim Editors | 07/2011 |
| |
L
LaTeX
| Der Grafikeditor Ipe | 11/2010 |
| Sketch – 3-D-Grafikcode für LaTeX erstellen | 02/2011 |
| Variable Argumente in LaTeX nutzen | 08/2011 |
| |
Linux allgemein
| Aptana Studio – Eine leistungsfähige Web-Entwicklungsumgebung | 10/2011 |
| Datenströme, Dateideskriptoren und Interprozesskommunikation | 03/2011 |
| Die Nachteile der Paketabhängigkeiten | 10/2011 |
| Erweitertes RC-System von OpenBSD | 11/2011 |
| Kernel-Crash-Analyse unter Linux | 02/2011 |
| Linux als ISDN-Telefon | 01/2011 |
| Plattformen für die Entwicklung und Verwaltung von Open-Source-Projekten | 09/2011 |
| |
M
Magazin
| Dritter freiesMagazin-Programmierwettbewerb beendet | 02/2011 |
| Vierter freiesMagazin-Programmierwettbewerb | 10/2011 |
| |
Multimedia
| Dateigrößenoptimierung von Bildern | 05/2011 |
| GIMP-Tutorial: Farben durch Graustufen hervorheben (Colorkey) | 03/2011 |
| Webcambilder einlesen und bearbeiten mit Python und OpenCV | 07/2011 |
| |
N
Netzwerk
| Freie Webanalytik mit Piwik | 08/2011 |
| Gesunde Datenkekse backen – Firefox mit Erweiterungen absichern | 03/2011 |
| Rezension: Root-Server einrichten und absichern | 02/2011 |
| Teile und herrsche – Internet-Sharing im Netzwerk | 01/2011 |
| UnrealIRC – gestern „Flurfunk“, heute „Chat“ | 06/2011 |
| Webzugriff | 08/2011 |
| |
O
Office-Suite
| Rezension: LibreOffice – kurz & gut | 12/2011 |
| Test: OpenDocument-Format für den Datenaustausch | 04/2011 |
| |
Open Document Format
| Test: OpenDocument-Format für den Datenaustausch | 04/2011 |
| |
P
PDF
| PDFs verkleinern mit pdfsizeopt | 01/2011 |
| |
PHP
| PHP-Programmierung – Teil 1: HTML | 10/2011 |
| PHP-Programmierung – Teil 2: Kontrollstrukturen | 11/2011 |
| PHP-Programmierung – Teil 3: Arrays, Sessions, Sicherheit | 12/2011 |
| |
Paketverwaltung
| Die Nachteile der Paketabhängigkeiten | 10/2011 |
| |
Perl
| Perl-Tutorial: Teil 0 – Was ist Perl? | 07/2011 |
| Perl-Tutorium: Teil 1 – Das erste Programm | 08/2011 |
| Perl-Tutorium: Teil 2 – Literale, Arrays und Blöcke | 09/2011 |
| Perl-Tutorium: Teil 3 – Hashes, Schleifen und Subroutinen | 11/2011 |
| Perl-Tutorium: Teil 4 – Referenzen auf Arrays und Hashes | 12/2011 |
| |
Programmierung
| Aptana Studio – Eine leistungsfähige Web-Entwicklungsumgebung | 10/2011 |
| Bottle – Ein WSGI-Microframework für Python | 02/2011 |
| Datenströme, Dateideskriptoren und Interprozesskommunikation | 03/2011 |
| Dritter freiesMagazin-Programmierwettbewerb beendet | 02/2011 |
| Easy Game Scripting mit Lua (EGSL) | 07/2011 |
| Eine Einführung in die Programmiersprache Pike | 04/2011 |
| |
Programmierung (Fortsetzung)
| Google Code-In | 12/2011 |
| Grafikadventures entwickeln mit SLUDGE | 12/2011 |
| Heimautomatisierung für Hardwarebastler (Teil 3) | 06/2011 |
| KTurtle – Programmieren lernen mit der Schildkröte | 01/2011 |
| PHP-Programmierung – Teil 1: HTML | 10/2011 |
| PHP-Programmierung – Teil 2: Kontrollstrukturen | 11/2011 |
| PHP-Programmierung – Teil 3: Arrays, Sessions, Sicherheit | 12/2011 |
| Parallelisierung mit Scala | 05/2011 |
| Perl-Tutorial: Teil 0 – Was ist Perl? | 07/2011 |
| Perl-Tutorium: Teil 1 – Das erste Programm | 08/2011 |
| Perl-Tutorium: Teil 2 – Literale, Arrays und Blöcke | 09/2011 |
| Perl-Tutorium: Teil 3 – Hashes, Schleifen und Subroutinen | 11/2011 |
| Perl-Tutorium: Teil 4 – Referenzen auf Arrays und Hashes | 12/2011 |
| Plasma erobert die Welt | 01/2011 |
| Plattformen für die Entwicklung und Verwaltung von Open-Source-Projekten | 09/2011 |
| Programmieren mit Vala | 01/2011 |
| Python – Teil 10: Kurzer Prozess | 12/2011 |
| Python – Teil 4: Klassenunterschiede | 01/2011 |
| Python – Teil 5: In medias res | 02/2011 |
| Python – Teil 6: Datenbank für die Musikverwaltung | 03/2011 |
| Python – Teil 8: Schöner iterieren | 07/2011 |
| Python – Teil 9: Ab ins Netz! | 10/2011 |
| Python-Frameworks für HTML-Formulare | 12/2011 |
| Python-Programmierung: Teil 7 – Iteratoren | 05/2011 |
| Remote-Actors in Scala | 10/2011 |
| Ren'Py als Entwicklertool für 2-D-Spiele | 11/2011 |
| Rezension: Android 3 – Apps entwickeln mit dem Android SDK | 11/2011 |
| Rezension: Coders At Work | 03/2011 |
| Rezension: CouchDB | 12/2011 |
| Rezension: Einführung in die Android-Entwicklung | 10/2011 |
| Rezension: Essential SQLAlchemy | 04/2011 |
| |
Programmierung (Fortsetzung)
| Rezension: NetBeans Platform 7 – Das umfassende Handbuch | 11/2011 |
| Rezension: Python von Kopf bis Fuß | 09/2011 |
| Rezension: Seven Languages in Seven Weeks | 07/2011 |
| Rezension: The Python Standard Library by Example | 09/2011 |
| Variable Argumente in LaTeX nutzen | 08/2011 |
| Vierter freiesMagazin-Programmierwettbewerb | 10/2011 |
| Webcambilder einlesen und bearbeiten mit Python und OpenCV | 07/2011 |
| |
Python
| Bottle – Ein WSGI-Microframework für Python | 02/2011 |
| PDFs verkleinern mit pdfsizeopt | 01/2011 |
| Python – Teil 10: Kurzer Prozess | 12/2011 |
| Python – Teil 4: Klassenunterschiede | 01/2011 |
| Python – Teil 5: In medias res | 02/2011 |
| Python – Teil 6: Datenbank für die Musikverwaltung | 03/2011 |
| Python – Teil 8: Schöner iterieren | 07/2011 |
| Python – Teil 9: Ab ins Netz! | 10/2011 |
| Python-Frameworks für HTML-Formulare | 12/2011 |
| Python-Programmierung: Teil 7 – Iteratoren | 05/2011 |
| Rezension: Coding for Fun mit Python | 05/2011 |
| Rezension: Essential SQLAlchemy | 04/2011 |
| Rezension: Python von Kopf bis Fuß | 09/2011 |
| Rezension: The Python Standard Library by Example | 09/2011 |
| Webcambilder einlesen und bearbeiten mit Python und OpenCV | 07/2011 |
| |
R
Rezension
| Rezension: Android 3 – Apps entwickeln mit dem Android SDK | 11/2011 |
| Rezension: Bash – kurz & gut | 02/2011 |
| Rezension: Canvas – kurz & gut | 11/2011 |
| |
Rezension (Fortsetzung)
| Rezension: Coders At Work | 03/2011 |
| Rezension: Coding for Fun mit Python | 05/2011 |
| Rezension: Computergeschichte(n) – nicht nur für Geeks | 06/2011 |
| Rezension: CouchDB | 12/2011 |
| Rezension: Durchstarten mit HTML5 | 04/2011 |
| Rezension: Einführung in die Android-Entwicklung | 10/2011 |
| Rezension: Essential SQLAlchemy | 04/2011 |
| Rezension: LPI 301 | 08/2011 |
| Rezension: LibreOffice – kurz & gut | 12/2011 |
| Rezension: NetBeans Platform 7 – Das umfassende Handbuch | 11/2011 |
| Rezension: Praxiskurs Unix-Shell | 06/2011 |
| Rezension: Python von Kopf bis Fuß | 09/2011 |
| Rezension: Root-Server einrichten und absichern | 02/2011 |
| Rezension: Seven Languages in Seven Weeks | 07/2011 |
| Rezension: The Python Standard Library by Example | 09/2011 |
| Rezension: Vi and Vim Editors | 07/2011 |
| Rezension: VirtualBox – Installation, Anwendung, Praxis | 10/2011 |
| |
S
Sicherheit
| Gesunde Datenkekse backen – Firefox mit Erweiterungen absichern | 03/2011 |
| Wurmkur ohne Nebenwirkung – Virenentfernung mittels Live-CDs | 05/2011 |
| |
Spiele
| Easy Game Scripting mit Lua (EGSL) | 07/2011 |
| Grafikadventures entwickeln mit SLUDGE | 12/2011 |
| Kurzreview: Humble Indie Bundle 3 | 08/2011 |
| Kurzreview: Humble Voxatron Debut | 11/2011 |
| Ren'Py als Entwicklertool für 2-D-Spiele | 11/2011 |
| Ryzom – Das freie MMORPG | 05/2011 |
| Secret Maryo Chronicles – Pilzkönigreich war gestern | 03/2011 |
| |
Spiele (Fortsetzung)
| Simutrans – Schnelles Geld zu Lande, zu Wasser und in der Luft | 02/2011 |
| SpaceChem – Atome im Weltall | 04/2011 |
| Trine – Aller guten Dinge sind drei | 07/2011 |
| UnrealIRC – gestern „Flurfunk“, heute „Chat“ | 06/2011 |
| Über Benchmarks | 07/2011 |
| |
Systemverwaltung
| ArchivistaVM – Server-Virtualisierung für die Hosentasche mit USB-Stick | 12/2011 |
| Erweitertes RC-System von OpenBSD | 11/2011 |
| |
T
Terminverwaltung
| Zehn Jahre Warenwirtschaft C.U.O.N. | 05/2011 |
| |
U
Ubuntu
| Bericht von der Ubucon 2011 | 11/2011 |
| Ubuntu 11.04 – Vorstellung des Natty Narwhal | 06/2011 |
| Ubuntu und Kubuntu 11.10 | 11/2011 |
| Unity | 12/2011 |
| Was Natty antreibt: Ein Blick auf den Kernel von Ubuntu 11.04 | 05/2011 |
| |
V
Veranstaltung
| Bericht von der Ubucon 2011 | 11/2011 |
| |
Video
| Webcambilder einlesen und bearbeiten mit Python und OpenCV | 07/2011 |
| |
Virtualisierung
| ArchivistaVM – Server-Virtualisierung für die Hosentasche mit USB-Stick | 12/2011 |
| Rezension: VirtualBox – Installation, Anwendung, Praxis | 10/2011 |
| VirtualBox und KVM | 02/2011 |
| |
W
Wissen und Bildung
| Bericht von der Ubucon 2011 | 11/2011 |
| Freie Software in der Schule – sinnvoll oder nicht? | 11/2011 |
| KTurtle – Programmieren lernen mit der Schildkröte | 01/2011 |
| |
freiesMagazin erscheint immer am ersten Sonntag eines Monats. Die Januar-Ausgabe wird voraussichtlich am 8. Januar unter anderem mit folgenden Themen veröffentlicht:
- Fedora 16
- Theme Hospital & CorsixTH
- Rezension: X-Plane kompakt
Es kann leider vorkommen, dass wir aus internen Gründen angekündigte Artikel verschieben müssen. Wir bitten dafür um Verständnis.
Zum Index
An einigen Stellen benutzen wir Sonderzeichen mit einer bestimmten
Bedeutung. Diese sind hier zusammengefasst:
| $: | Shell-Prompt |
| #: | Prompt einer Root-Shell – Ubuntu-Nutzer können
hier auch einfach in einer normalen Shell ein
sudo vor die Befehle setzen. |
| ~: | Abkürzung für das eigene Benutzerverzeichnis
/home/BENUTZERNAME |
Zum Index
|
| Erscheinungsdatum: 4. Dezember 2011 |
|
|
| Redaktion |
| Dominik Honnef | Thorsten Schmidt |
| Matthias Sitte | |
| Dominik Wagenführ (Verantwortlicher Redakteur) |
| |
| Satz und Layout |
| Ralf Damaschke | Andrej Giesbrecht |
| Tobias Kempfer | Nico Maikowski |
| Ralph Pavenstädt | |
| |
| Korrektur |
| Andreas Breitbach | Daniel Braun |
| Frank Brungräber | Bastian Bührig |
| Vicki Ebeling | Stefan Fangmeier |
| Mathias Menzer | Florian Rummler |
| Karsten Schuldt | Stephan Walter |
| Toni Zimmer | |
| |
| Veranstaltungen |
| Ronny Fischer |
| |
| Logo-Design |
| Arne Weinberg (GNU FDL) |
| |
Dieses Magazin wurde mit LaTeX erstellt. Mit vollem Namen
gekennzeichnete Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung
der Redaktion wieder. Wenn Sie
freiesMagazin ausdrucken möchten, dann
denken Sie bitte an die Umwelt und drucken Sie nur im Notfall. Die
Bäume werden es Ihnen danken. ;-)
Soweit nicht anders angegeben, stehen alle Artikel, Beiträge und Bilder in
freiesMagazin unter der
Creative-Commons-Lizenz CC-BY-SA 3.0 Unported. Das Copyright liegt
beim jeweiligen Autor.
freiesMagazin unterliegt als Gesamtwerk ebenso
der
Creative-Commons-Lizenz CC-BY-SA 3.0 Unported mit Ausnahme der
Inhalte, die unter einer anderen Lizenz hierin veröffentlicht
werden. Das Copyright liegt bei Dominik Wagenführ. Es wird erlaubt,
das Werk/die Werke unter den Bestimmungen der Creative-Commons-Lizenz
zu kopieren, zu verteilen und/oder zu modifizieren. Das
freiesMagazin-Logo
wurde von Arne Weinberg erstellt und unterliegt der
GFDL.
Die xkcd-Comics stehen separat unter der
Creative-Commons-Lizenz CC-BY-NC 2.5 Generic. Das Copyright liegt
bei
Randall Munroe.
Zum Index
File translated from
TEX
by
TTH,
version 3.89.
On 2 Jan 2012, 10:20.